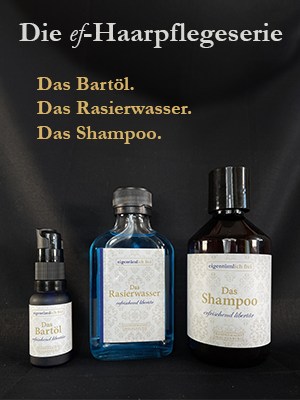Gesellschaft und Wirtschaft: Ohne Privateigentum keine Freiheit
Die Schlüsselfrage der Gesellschaftsordnung

Der Begriff des „Eigentums“ ist in Auflösung begriffen. Seine Zersetzung ist bereits im Grundgesetz (1949) in Artikel 14 angelegt. Dort heißt es einerseits, dass Eigentum (und Erbrecht) „gewährleistet“ wird, andererseits aber „Inhalt und Schranken“ durch die Gesetze bestimmt werden. In gleicher Weise die Eigentumsrechte einschränkend heißt es in Absatz 2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Für die BRD kann von einer echten Eigentumsordnung keine Rede sein. Den Eingriffen in die Eigentumsrechte sind juristisch Tür und Tor geöffnet. Es darf nicht verwundern, dass die herrschenden Parteien diese offene Pforte hemmungslos durchschreiten.
Im Eigentumsbegriff ist der Kern des Gesellschaftlichen lokalisiert. Privateigentum, spezifisch das an Produktionsmitteln, ist der Kern der politischen Forderungen des klassischen Liberalismus. Im Konflikt über die Rolle des Eigentums steht der Liberalismus dem Sozialismus gegenüber. Die unterschiedliche Auffassung zwischen beiden Systemen kristallisiert sich in der Frage, ob Eigentum individualistisch oder kollektivistisch zu bestimmen ist. Während Ludwig von Mises erklärt, dass für den Liberalismus „Eigentum, das heißt: Sondereigentum an den Produktionsmitteln“ der Kern des liberalen Programms ist (Liberalismus, 1927, Seite 17) und dass sich aus dieser Grundforderung alle anderen Forderungen des Liberalismus ergeben, steht im „Kommunistischen Manifest“ (MEW, Band IV, Seite 475), dass die Kommunisten ihr Programm „in dem einen Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen (können)“.
Privateigentum im Unterschied zum Gemeineigentum und Individualismus im Unterschied zum Kollektivismus kennzeichnen Liberalismus und Sozialismus. Das für diese Unterscheidung geltende Kriterium ist das Privateigentum. An diesem Zwiespalt zeigt sich auch, dass ein Mischsystem wie die „Soziale Marktwirtschaft“ der Transformation ausgesetzt ist. Die Sozialpolitik, gedacht als Stabilisator des Marktkapitalismus, ist das Einfallstor des Sozialismus. Als Resultat entsteht der Staatskapitalismus als ein System, welches das Privateigentum formal bestehen bleiben lässt, aber materiell immer mehr aushöhlt. Deshalb ist der Begriff „Bürgergeld“ für die ehemals „Sozialhilfe“ genannten Transfers so absurd und im Grunde eine zynische Täuschung.
Hier gilt es, sich erneut der Worte von Ludwig von Mises zu erinnern, für den das Sondereigentum an den Produktionsmitteln die Basis auch aller anderen Freiheitswerte bildet: „Die wesentliche Lehre des Liberalismus ist, dass die gesellschaftliche Kooperation und die Arbeitsteilung nur in einem auf dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln, das heißt in einer Marktwirtschaft, dem Kapitalismus beruhenden Wirtschaftsverfassung verwirklicht werden können. Alle anderen Prinzipien des Liberalismus – Demokratie, persönliche Freiheit des Einzelnen, Rede- und Pressefreiheit, religiöse Toleranz, Frieden zwischen den Völkern – sind Folgen dieses Grundpostulats. Sie können nur in einer Gesellschaft verwirklicht werden, die auf Sondereigentum basiert“ (Ludwig von Mises: „Allmächtiger Staat“, 1944).
Der Staat strebt nach außen wie nach innen die volle Herrschaft an. Totalitarismus ist keine Abirrung des Staates, sondern staatliche Machtübergriffe werden stets überall dort auftreten, wo die Gegenkräfte zu schwach geworden sind, um die hegemonialen Bestrebungen des Staates zu bändigen. In der Tat können wir heute beobachten, wie zusammen mit der Auflösung des Privateigentums die anderen Werte des Liberalismus verfallen.
Auch für die Anarchisten, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, liegt im Eigentumsbegriff der Zugang zum Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft. Bezeichnend für diese Auseinandersetzung innerhalb der anarchistischen Bewegung ist hier Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), der das Eigentum als eine „revolutionäre Macht“ bestimmt, um die Staatsmacht auszugleichen. Hatte er einst in jugendlichem Überschwang verkündet „Eigentum ist Diebstahl“, erkannte er in seinen späteren Jahren: „Wo können wir eine Macht finden, die in der Lage ist, die gewaltige Macht des Staates auszugleichen? Es gibt nichts anderes als Eigentum. Die Staaten, in denen Freiheit und Gleichheit am meisten herrschen, sind die, in denen das Eigentum herrscht“ (Pierre-Joseph Proudhon: „Théorie de la propriété“, 1866).
Nachdrücklich zeigt sich das Wesen des Privateigentums in Bezug auf den eigenen Körper, den jemand als Person immer schon besitzt und der einem, so wie das Leben, als persönliches Eigentum schon vor jedem Gesetz gegeben ist. Da der Körper dem einzelnen Menschen als Eigentum schon gehört, kann er ihm durch das positive Recht nicht gegeben, sondern als negativer Akt nur weggenommen werden. Einem freigelassenen Sklaven zum Beispiel kann die Freiheit nicht „geschenkt“ werden, sondern ihm wird mit der Entlassung aus der Sklaverei nur das wiedergegeben, was ihm genommen wurde.
Einschränkungen der Freiheit des Individuums können nie etwas anderes als Willkür sein. Dies erkennt man plastisch daran, wie unterschiedlich die Freiheitseinschränkungen von einem Staat zu einem anderen, von einem Bundesland zu einem anderen oder, wie zum Beispiel in den USA oder der Schweiz, von einem Bezirk zum anderen oder von einem Kanton zum nächsten sind – nicht davon zu sprechen, dass sich die Einschränkungen der Freiheit von Epoche zu Epoche oft tiefgreifend wandeln.
Allerdings kann man Teile seiner Eigentumsrechte freiwillig aufgeben. Es bedarf keiner rechtfertigenden Verkündigung, wenn sich der Einzelne wechselseitig anerkannten Regeln unterwirft. Das fängt schon beim Spielen an. Wenn jemand zum Beispiel an einem Pokerspiel teilnimmt, unterwirft er sich den ausgemachten Regeln dieses Spiels. Indem der Einzelne dies tut, handelt er willkürlich, wobei aber dieser Willkürakt dem Willen des Einzelnen unterliegt, also freiwillig erfolgt. Eine derartige Gemeinschaftsbildung ist legitim, auch wenn sie die Freiheit des Einzelnen einschränkt.
Das Problem des Eigentums kennzeichnet die Schlüsselfrage der Gesellschaftsordnung. Von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) stammt der bemerkenswerte Gedanke, dass das Eigentumsrecht als die Freiheit „einer einzelnen, sich nur zu sich verhaltenden Person“ zu fassen sei (Paragraph 40 in Grundlinien der Philosophie des Rechts). In Paragraph 46 dieser seiner Rechtslehre (1820) erklärt er prägnant: „Da mir im Eigentum mein Wille als persönlicher, somit als Wille des Einzelnen objektiv wird, so erhält es den Charakter von Privateigentum, und gemeinschaftliches Eigentum, das seiner Natur nach vereinzelt besessen werden kann, die Bestimmung von einer an sich auflösbaren Gemeinschaft, in der meinen Anteil zu lassen für sich Sache der Willkür ist.“
Die hegelsche Argumentation lautet somit, dass, weil der individuelle Wille persönlicher Wille ist, Eigentum nur Privateigentum sein kann. Eigentum besteht nicht als Recht, sondern aus dem persönlichen Willen heraus. Das Recht, in Form der jeweils herrschenden Gesetze, kommt erst nachträglich ins Spiel, und zwar negativ, indem es die ursprüngliche absolute individuelle Macht über das individuelle Eigentum einschränkt, das Eigentumsrecht also relativiert.
Nach dieser Auffassung widerspricht staatliche Umverteilung durch staatlichen Zwang dem „Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft“ und verstößt gegen das Prinzip der Selbständigkeit und verletzt die Ehre des Individuums (Hegel, Rechtslehre Paragraph 245). Eigentum ist durch eigene Tätigkeit zu erwerben. In einer bürgerlichen Gesellschaft hat jeder Einzelne das Recht auf die Möglichkeit der Teilnahme am Wirtschaftsprozess der Produktion und des Gütertausches. Umverteilung darf nicht das Ziel des bürgerlichen Staates sein, da diese dem Grundprinzip der bürgerlichen Arbeits- und Tauschgesellschaft widerspricht. Der bürgerliche Staat kann das Eigentum nicht „gewähren“, denn es gehört schon dem Menschen. Die staatliche Gemeinschaft hat lediglich dafür zu sorgen, dass Eigentum erworben werden kann. Handelt der Staat anders, führt er sich als bürgerlicher Staat ad absurdum und treibt seiner Auflösung entgegen. So ein Staat mag als Zwangsanstalt weiter existieren, aber er ist kein bürgerlicher Staat mehr.
Antony P. Mueller: „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“ (2021)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.