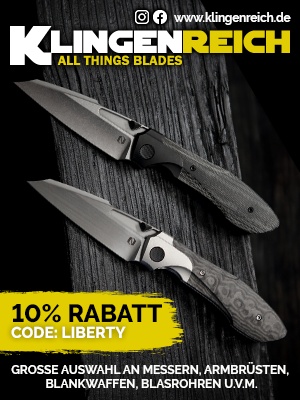Wirtschaftsprotektionismus: Merkantilismus à la Donald Trump
Die Zeche zahlen am Ende immer die Konsumenten
von Andreas Tögel drucken

Darüber, ob die Unberechenbarkeit des neuen US-Präsidenten als Stärke oder als Schwäche zu bewerten ist, streiten die Auguren. Einige seiner in den letzten Wochen getätigten Ankündigungen scheinen jedenfalls, gelinde gesagt, etwas unausgegoren zu sein – etwa die Idee von der „Eingemeindung“ Kanadas in die USA (was nämlich zur Folge hätte, dass es in „Gods own Country“ vermutlich nie wieder einen republikanischen Präidenten gäbe, siehe untenstehenden Link).
Schon vor seiner Amtseinführung hatte Donald Trump angekündigt, im Zuge seines Maga-Programms („Make America Great Again“) eine Reihe von Handelspartnern mit Strafzöllen belegen zu wollen. Eines der Ziele dieser freihandelsschädlichen Politik ist die Europäische Union, die sich gegenüber den USA angeblich „unfair“ verhalte. Beispielsweise, weil in Europa, so Trump, zu wenige von US-Herstellern gebaute Autos gekauft werden. Inwieweit der Absatz von für europäische Konsumenten schlicht unattraktiven US-Karren beflügelt werden kann, indem künftig Stahl- und Aluminiumimporte aus Euro-Land mit Zöllen in der Höhe von 25 Prozent belegt werden, liegt allerdings im Dunkeln.
Wie liberale Ökonomen nicht müde werden zu betonen, stellen Zölle nicht mehr und nicht weniger als ein Handelshemmnis dar. Sie verzerren die Wettbewerbsstruktur zu ihrem Nachteil. Es wäre doch absolut verrückt, wenn in Brandenburg plötzlich Zölle auf Lieferungen aus Sachsen erhoben würden. Wenn es aber innerhalb von Staatsgrenzen keine Zölle gibt, warum dann auf grenzüberschreitende Warenlieferungen? Wo bleibt – außer gegenleistungsfreien Einnahmen für den Fiskus – der Witz?
Im Gegensatz zur gar nicht so fernen Vergangenheit, als Zölle der Staatsfinanzierung dienten, weil Einkommensteuern noch nicht erfunden waren, fungieren sie heutzutage bevorzugt als Mittel des Wirtschaftsprotektionismus: US-Stahlhersteller sollen nach dem Willen des Präsidenten durch Zölle auf Importe aus Übersee vor preiswerterer Konkurrenz geschützt werden. Das ist zwar überaus angenehm für die amerikanischen Stahlkocher, weil die es sich nun in einem Quasi-Monopol gemütlich einrichten können. Für sämtliche Abnehmer von Stahl-Halbzeugen, wie Fahrzeug- und Maschinenbauer, ist das natürlich weit weniger erfreulich, da sie dann zu höheren Preisen einkaufen müssen. Außerdem werden höhere Materialeinstandskosten klarerweise zu Preissteigerungen für die Endprodukte führen und damit einen preisinflationären Effekt entfalten. Die Zeche zahlen also nicht nur europäische Aluminium- und Stahlproduzenten, sondern am Ende auch die amerikanischen Konsumenten.
Zölle spielten zur Zeit des vom 16. bis ins 18. Jahrhundert von mehreren Staaten Europas praktizierten Merkantilismus eine gewichtige Rolle – allen voran in Frankreich unter Ludwig XIV. und dessen Finanzminister Colbert. Wirtschaft und grenzüberschreitender Handel wurden zu dieser Zeit nicht als kooperatives System zum gemeinsamen Vorteil infolge einer internationalen Arbeitsteilung verstanden, sondern als Mittel, um dem Inland Vorteile auf Kosten des Auslands zu verschaffen. Eigene Exporte wurden begünstigt, Importe dagegen eingeschränkt.
Heutzutage, da das wohlstandsfördernde Prinzip der Arbeitsteilung seit Adam Smith weithin unbestritten ist, sind alle Bestrebungen, dieser entgegenzuwirken, strikt abzulehnen.
Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, wie Politik und Bürokratie dazu kommen, sich anzumaßen, in die wirtschaftliche Kooperation zwischen privaten Akteuren (Unternehmen und Privatpersonen in verschiedenen Ländern) einzugreifen. Wenn Privatbetriebe Vertriebsstrukturen jenseits von Staatsgrenzen aufbauen und es zudem schaffen, ihre Produkte dort profitabel zu vermarkten, dann ist es nichts weniger als unerhört, dass ganz und gar unproduktive Politiker und Staatsbürokraten diese erfolgreichen Bemühungen mittels willkürlicher Störaktionen sabotieren. Wie kommen findige Lebensmittel- oder Maschinenproduzenten dazu, dass ihre Exporte durch politisch motivierte Handelsembargos, Sanktionen oder eben Einfuhrzölle behindert werden? Wer ersetzt denn den betroffenen Betrieben und deren Mitarbeitern den dadurch entstehenden Schaden? Wer verantwortet den dadurch bedingten Preisauftrieb? Die in jedem Fall ungestraft ihre Narrenfreiheit genießende Kaste von Politikern und Bürokraten jedenfalls nicht!
Annexing Canada Would Be Like Adding a Second California (Mises Institute)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.