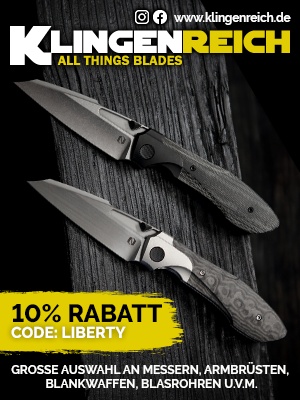Ökonomie: Rothbards Beiträge zur Theorie der öffentlichen Güter
Über die Rechtfertigung von Staatseingriffen
von Karl-Friedrich Israel drucken

Eine der Hauptbegründungen für die Bereitstellung eines Gutes durch den Staat ist, dass es sich um ein „öffentliches Gut“ handelt. Öffentliche Güter erfüllen zwei Kriterien. Erstens sind die Kosten eines privaten Herstellers zu hoch, um Nichtzahler vom Genuss des Gutes auszuschließen. Ökonomen sprechen von Nichtausschließbarkeit im Konsum. Zweitens beeinträchtigt der Genuss des Gutes durch eine Person niemand anderes dabei, das Gut ebenfalls zu genießen. Dies nennen Ökonomen Nichtrivalität im Konsum. Die Bereitstellung solcher Güter auf freiwilliger Basis wird entweder als unmöglich oder zumindest als ineffizient im Vergleich zur staatlichen Bereitstellung angesehen. Rationale Individuen werden sich dafür entscheiden, das Gut als Trittbrettfahrer zu genießen, ohne dafür zu bezahlen. Infolgedessen wird die Bereitstellung des Gutes auf dem Markt zu einer Unterproduktion führen, da Unternehmen für die Bereitstellung nicht hinreichend entlohnt werden. Es wäre theoretisch denkbar, dass der Anbieter mit allen Begünstigten einen Vertrag abschließt, um sie zur Zahlung zu bewegen, bevor das Gut produziert wird. In der Praxis wären die Transaktionskosten dieser Vertragsverhandlungen jedoch prohibitiv. Daher bietet der Zwangsapparat des Staates einen effizienteren Bereitstellungsmechanismus, da er alle Nutznießer ohne Verhandlungen dazu zwingen kann, für das öffentliche Gut zu zahlen. Das Trittbrettfahrerproblem wird auf diese Weise überwunden.
Murray Rothbard lehnte diese Analyse ab und bestritt, dass der Staat in der Lage sei, Güter durch Zwang besser bereitzustellen als frei handelnde Individuen durch freiwillige Kooperation. Individuen organisieren sich freiwillig und tragen zu allen Arten von Aktivitäten auf dem Markt bei, einschließlich gemeinsamer Projekte, die deutlich mehr Menschen zugutekommen als den direkt Beitragenden selbst, das heißt, die „positive externe Effekte“ erzeugen.
Die Kritiker von Rothbard haben ihn immer wieder falsch verstanden, sei es als Verteidiger der Public-Choice-Ökonomie oder der neoklassischen Mainstream-Ökonomie. Die Mehrheit der Ökonomen lebt leider in völliger Unkenntnis über Rothbards Beiträge im Bereich der Theorie der öffentlichen Güter. Das trifft sogar auf manche Ökonomen der Österreichischen Schule zu.
Lawson und Clark haben zum Beispiel in einem Beitrag in der „Review of Austrian Economics“ die Rothbard’sche Position aufgegriffen und ihn beschuldigt, ein „Leugner öffentlicher Güter“ zu sein. Er sei „intellektuell schlampig“, weil er die Ideen öffentlicher Güter und externer Effekte „lächerlich“ gemacht habe. Sie erkennen zwar an, dass „wir die Mises’schen und Hayek’schen Bedenken über die Grenzen des Wissens in Abwesenheit von Marktpreissignalen ernst nehmen sollten“. Aber jeder, der diese Bedenken vollkommen zu schätzen weiß, würde Rothbard nicht so schnell abweisen.
Lawson und Clark stellen zwei Szenarien von öffentlichen Gütern und externen Effekten vor, bei denen Personen, die ein bestimmtes Gut wünschen, kollektiv bereit sind, mehr dafür zu zahlen, als für dessen Bereitstellung erforderlich wäre. Diese Szenarien sollen zeigen, dass Rothbard unrecht hatte. In ihrem ersten Beispiel sind die Einwohner einer Stadt kollektiv bereit, mehr zu zahlen, als für den Bau eines öffentlichen Parks erforderlich wäre. Im zweiten Szenario ist eine Gruppe von Hobby-Astronomen bereit, mehr zu zahlen, als nötig wäre, um die übrigen Stadtbewohner dazu zu bringen, ihre Lichter auszuschalten, damit sie die Sterne beobachten können.
Aufgrund der Probleme von Trittbrettfahrern und Transaktionskosten kann der Markt diese gewünschten Güter nicht produzieren. Glücklicherweise ist der Staat in der Lage, Trittbrettfahrer zu besteuern, um die Herstellung dieser Güter zu ermöglichen. Die Tatsache, dass manche Menschen diese Güter gar nicht wertschätzen, ist kein Problem, denn „solange die gesamte Zahlungsbereitschaft der Gemeinschaft die Kosten für den Bau übersteigt, ist es möglich, ein Steuersystem zu entwerfen, bei dem jeder Einzelne besser gestellt ist“.
Diese Beispiele schreien zum Himmel. Sie verdrängen das Problem, statt es zu lösen. Woher genau wissen die Ökonomen oder Politiker, dass die Menschen eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, als sie in der Praxis durch ihre Kaufentscheidungen zeigen? Rothbard beharrt darauf, dass sie es schlichtweg nicht wissen – sie ersetzen einfach ihre eigenen Wertvorstellungen durch die der zu belastenden Steuerzahler und hüllen ihre Ansichten dann „in die ‚wissenschaftliche‘ Meinung, dass in diesen Fällen marktwirtschaftliches Handeln nicht mehr optimal ist, sondern durch korrigierende staatliche Maßnahmen wieder in die Optimalität zurückgeführt werden sollte. Eine solche Sichtweise verkennt völlig die Art und Weise, in der die Wirtschaftswissenschaft behauptet, dass marktwirtschaftliches Handeln optimal ist. Es ist optimal, nicht vom Standpunkt der persönlichen ethischen Ansichten eines Ökonomen aus, sondern vom Standpunkt des freien, freiwilligen Handelns aller Teilnehmer und der Befriedigung der frei geäußerten Bedürfnisse der Verbraucher.“
Die Behauptung von Lawson und Clark, dass „steuerfinanzierte öffentliche Güter uns alle, buchstäblich jeden Einzelnen von uns, besserstellen können“, ist genau das: eine bloße Behauptung. Lawson und Clark gehen von einer Annahme aus, dessen Wahrheit nur durch das freiwillige Handeln von Individuen auf dem freien Markt ermittelt werden kann. Es gibt keine wissenschaftliche Methode, um nachzuweisen, dass es den Menschen durch Besteuerung und staatliche Bereitstellung von Gütern besser geht.
Lawson und Clark argumentieren, dass private Unternehmen öffentliche Güter unterproduzieren. Aber wie können sie wissen, ob ein Gut „unterproduziert“ ist? Wie können sie unterscheiden zwischen einer Situation, in der die Menschen nicht bereit sind, für mehr von einem Gut zu zahlen, und einer Situation, in der sie bereit wären zu zahlen, es aber wegen der Transaktionskosten nicht tun? Selbst wenn die Menschen aufgrund der Transaktionskosten nicht bereit sind, ein Projekt durchzuführen, zeigt dies lediglich, dass der Wert des Projekts für sie geringer ist als ihre Opportunitätskosten. Die Wirtschaftswissenschaft kann nicht nachweisen, dass ein Gut „unterproduziert“ ist, weshalb Rothbard feststellt, dass Ökonomen, die behaupten, die staatliche Produktion oder Subventionierung von Gütern würde die Wohlfahrt verbessern, dies nicht auf der Grundlage der Wissenschaft tun. Sie schmuggeln einfach ihre eigenen Präferenzen in ihre vermeintlich wertfreie Analyse unter dem Deckmantel der „öffentlichen Güter“. Rothbard erinnert uns daran, dass wir in diesem Fall nicht davon ausgehen können, dass wir die tatsächliche Zahlungsbereitschaft des Einzelnen kennen. Der alte Witz, in dem der Ökonom zum Öffnen einer Konservendose einfach annimmt, er habe einen Dosenöffner, entfaltet vor diesem Hintergrund seine volle Bedeutung. Der Ökonom, der das Standardargument für öffentliche Güter ins Feld führt, nimmt Dinge an, die uns in der Praxis immer verborgen bleiben.
Leider werden Rothbards Beiträge zu diesem Thema von vielen, die sich selbst als Ökonomen der freien Marktwirtschaft betrachten, entweder ignoriert oder missverstanden. Sie ignorieren die einfache Wahrheit, dass die bloße Möglichkeit einer steuerfinanzierten Bereitstellung öffentlicher Güter, durch die es „uns allen, buchstäblich jedem von uns, besser geht“, kein gutes Argument für Staatseingriffe ist. Es ist ein ebenso gutes Argument für Staatseingriffe wie die bloße Möglichkeit, den Jackpot zu knacken, ein gutes Argument dafür ist, Münzen in einen Spielautomaten zu werfen. Man mag es persönlich aus Spaß an der Freude tun, aber man erwartet nicht, dass man gewinnt. Tatsächlich haben Lawson und Clark die Sache völlig falsch verstanden. Wenn die Bereitstellung öffentlicher Güter zum gegenseitigen Nutzen möglich ist, braucht es keinen Staat. Im Gegensatz zum Glücksspieler, der zumindest feststellen kann, ob sein Gewinn seine Verluste übersteigt (und ob das Vergnügen am Spiel den Geldverlust übersteigt), gibt es für die Interventionisten, die öffentliche Güter bereitstellen, keine Möglichkeit zu wissen, ob die Güter mehr oder weniger wert sind als die Kosten, die der Öffentlichkeit auferlegt werden. Die Analyse öffentlicher Güter muss sich, wenn sie wissenschaftlich sein soll, an Rothbards strengen Vorgaben orientieren.
Murray Rothbard (1956): Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics
Murray Rothbard (1961): The Fallacy of the “Public Sector”
Murray Rothbard (1962): Man, Economy, and State
Lawson, R.A., Clark, J.R. (2019): Taxation in the Liberal Tradition
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.