Libertäre Philosophie – Teil 2: Laotse: Der Weise wirkt ohne Gewalt
Der libertäre Auftrag der morgenländischen Philosophie
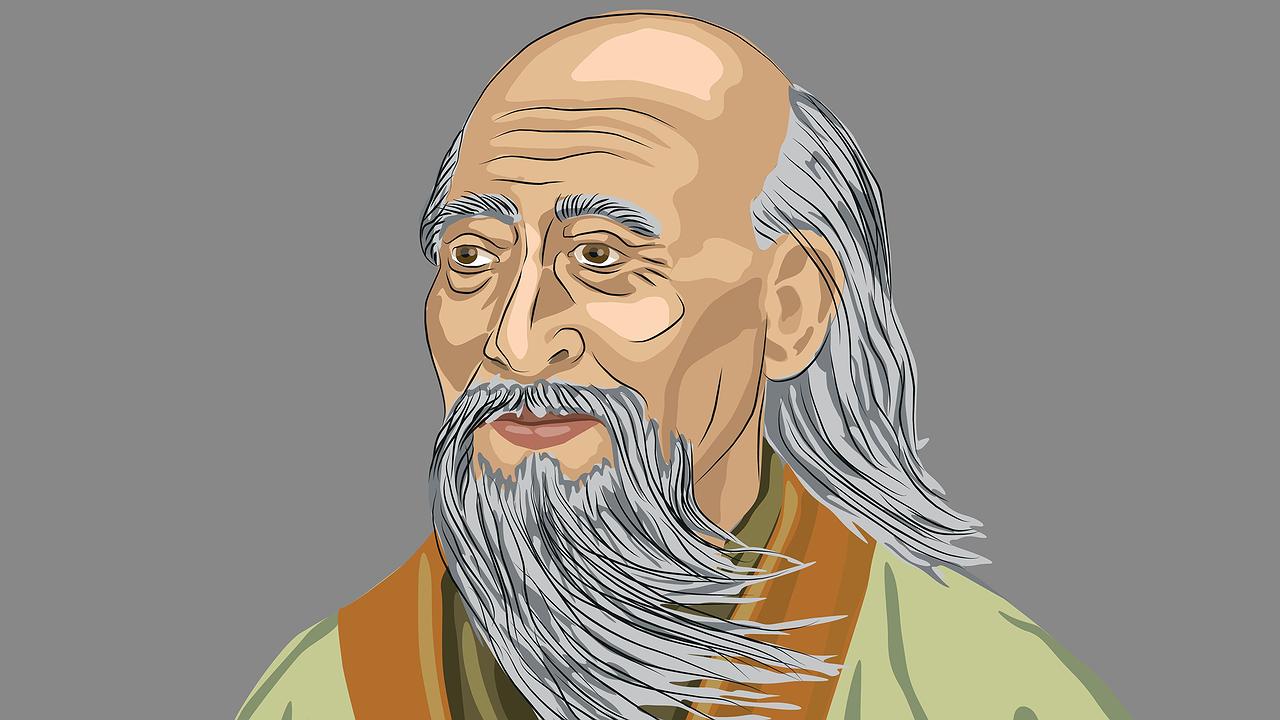
Irgendwo in China. Sechstes Jahrhundert vor Christus? Fünftes Jahrhundert? Über Laotse (früher meist Lao-Tse transkribiert) ist nichts wirklich bekannt, die Legenden sind alle erst Jahrhunderte später entstanden. Wie auch im Abendland mit Sokrates, hebt die asiatische Philosophie mit einem libertären Paukenschlag an. Laotse wird eine schmale Spruchsammlung unter dem Namen Daodejing (früher: Tao Te King) zugeschrieben, die den Daoismus (Taoismus) begründete und eine weltumspannende Wirkung erzielte. Die Legende um die Entstehung der Spruchsammlung hat Bertolt Brecht 1938 in einem allerliebsten Gedicht wunderbar erzählt: „Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration“. Der betagte Laotse verlässt seine Heimat, weil er die dortigen politischen Verhältnisse nicht mehr erträgt. An der Grenze hält ihn ein Zöllner auf, der in ihm einen großen Weisen erkennt und ihn dazu auffordert, seine Weisheit für die Nachwelt zu erhalten und aufzuschreiben. So entsteht in einer Nacht das Daodejing. Während Sokrates von der herrschenden Mehrheit zum Tode verurteilt wird und damit den einen Urtyp der Verfolgung darstellt, den Märtyrer, steht Laotse für den anderen Urtyp, den Flüchtling, der aufgrund unerträglicher Verhältnisse ins Exil geht.
Was Laotse abliefert, hat es in sich. Seine Weisheit kreist um die Frage des richtigen Wegs (Dao). Der richtige Weg, so heißt es eins ums andere Mal in den Versen der Sammlung, besteht nicht darin, das Gute zu erzwingen. Es lässt sich nicht erzwingen. Der Weise wirkt ohne Gewalt. Er hält sich zurück, er wartet ab, bis die Dinge von selber reifen. Er tut nichts und doch bleibt nichts ungetan.
Ausdrücklich schließt Laotse hierin das wirtschaftliche Handeln ein. Der Weise – und an dieser Stelle wird klar, dass er damit den politisch Herrschenden meint – mischt sich nicht ein in das, was die Menschen tun. Auf diese Weise werde sich alles wunderbar richten. Umgekehrt, wenn er sich einmische, folgten daraus unmittelbar der wirtschaftliche Niedergang und das materielle Elend der Bevölkerung. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die urliberale Formel des „Laisser-faire“ (laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même: loslassen, geschehen lassen, die Welt dreht sich schon von allein) dem daoistischen „wu wai“ (Nichttun) nicht nur von der Idee her ähnelt, sondern tatsächlich ein Versuch ist, die Weisheit Laotses ins Französische zu transportieren.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Entwicklung morgen- und abendländischer Philosophie wird allerdings schon hier im Ursprung deutlich. Sokrates wurde wegen Gottlosigkeit angeklagt. Obwohl er dieser Anklage damit begegnete, er sei seinem persönlichen Gott ergeben, haben seine Schüler, ebenso wenig wie die Schüler Platons und Aristoteles’ oder anderer griechischer und römischer Philosophen, je eine Religion begründet. Anders der Daoismus. Er verband sich mit vorhandenen religiösen Glaubensinhalten und begründete eigene neue, er beinhaltet Meditation, Rituale, Alchemie, Magie und Mystik. Insofern gilt er als Weltreligion, weil er in ganz Asien Fuß fasste. Als einzige Weltreligion hat er nie und nirgends sich mit der politischen Herrschaft verbunden und ihr zugearbeitet, ihr die Ideologie für Gewaltausübung geliefert. Als im dritten Jahrhundert nach Christus der Buddhismus (siehe Folge 7) in China eindringt, werden ihn die ersten Übersetzer als eine merkwürdige Abart des Daoismus interpretieren und auf diese Weise ins Chinesische übertragen. Dadurch entsteht der Zen-Buddhismus (das Zen ergibt sich aus einer Lautverschiebung aus Dao).
Der Daoismus wird in der Folgezeit nie und nirgends den Einfluss erlangen, um irgendwo die gesellschaftlichen Verhältnisse zu bestimmen. Aber zugleich erkennt die chinesische Tradition ihn immer, neben Buddhismus und Konfuzianismus (Folge 6), als eine entscheidende Lehre an, die es zu beachten gilt, und zwar als Gegengewicht zu starren Ordnungsvorstellungen.
Ja, es gibt sie, die Unterschiede zwischen abend- und morgenländischer Philosophie. Einen habe ich gerade genannt. Doch erscheint mir dieser Unterschied eher äußerlichen kulturellen Umständen zu entspringen. Das Wesen der Philosophie liegt viel näher beieinander, als gemeinhin angenommen wird. Die Unterschiede innerhalb der Philosophie gehen quer zu den geographischen und kulturellen Unterschieden: Der Ursprung der morgen- wie der abendländischen Philosophie ist zutiefst libertär. Es geht um den Anspruch der Wahrheitssuche als eines Prozesses von Weisheit, Dialog und Nachdenken gegenüber den Behauptungen der Herrschenden, die Wahrheit verkünden und per Dekret festschreiben zu können, zu dürfen und gar zu müssen. Die Lehre Laotses weist in ihrer libertären Radikalität noch weit über Sokrates hinaus, der sich (leider) zur Sozialstruktur wenig Gedanken gemacht zu haben scheint (es sei denn, Platon – Folge 3 dieser Serie – hätte diese aus Gründen seiner eigenen totalitären Staatslehre unterschlagen). Laotse dagegen spricht den Herrschern sowohl ab, notwendig zu sein als auch in irgendeiner Weise für die Menschen hilfreiche und heilsame Maßnahmen vornehmen zu können. Im Abendland wird es zweitausend Jahre dauern, bis diese Einsicht in der Philosophie Fuß fassen wird.
Der wesentliche Unterschied in der Philosophie ist nicht religiösen, geographischen oder kulturellen Ursprungs, sondern liegt in der Antwort auf die Frage, ob Herrschaft rational begründet werden könne oder nicht. Im Anfang der Philosophie steht, dass die vorhandene Herrschaft in Zweifel gezogen wird, sowohl von den abend- wie auch von den morgenländischen Philosophen. Erst nach diesem für die Herrschenden so gefährlichen Akt, der die Philosophie in ihrem Sein konstituiert, werden Hofphilosophen herangezüchtet, die dazu da sind, den Herrschenden Honig um den Bart zu schmieren. Doch gelingt dies, wie wir sehen werden, gar nicht so gut. Bereits die Frage, welche Gründe für die Herrschaft vorliegen, lässt zumindest immer die Denkmöglichkeit offen, dass die Gründe nicht gefunden werden. Und mehr noch: Sobald die Gründe formuliert worden sind, binden sie die Herrschenden. Wenn es ihnen in den Sinn kommt, dass sie nun etwas anderes wollen, müssen sie sich vor den Gründen rechtfertigen, die die Philosophen formuliert haben. Oder der jeweilige Hofphilosoph fällt kurzerhand in Ungnade, was meist damit endet, dass sein ehemaliger Gönner ihn einen Kopf kürzer macht. Die traurige Geschichte der Philosophen, die versuchten, sich Stalin, Hitler oder Mao anzudienen, erzählt davon.
Der weise Philosoph tut gut daran, sich nicht einzumischen. Nach Laotse beeinflusste Zhuangzi (365–290 vor Christus) den Daoismus entscheidend und ist fast genauso wichtig wie Laotse selber. Zhuangzi verschärft die politische Enthaltsamkeit Laotses. Während sich Laotse noch mit Ratschlägen an die Herrschenden wandte (wie es auch Konfuzius mit größerem Erfolg tat, siehe Folge 6), ist bei Zhuangzi davon nichts mehr übrig. Er wendet sich an die Mitmenschen und versucht, ihnen eine Weg zu einem friedlichen Miteinander zu weisen. Dies von den Herrschenden und der von ihnen angestrebten Ordnung zu erwarten, wäre ihm zufolge eitel. Sie würden alles nur noch schlimmer machen. Ganz offen rät Zhuangzi den Mitmenschen, die „Heiligen“ zu vertreiben. Mit ihnen bezeichnet er jene, die meinen, eine allgemeingültige Ordnung von richtig und falsch jenseits der pragmatischen täglichen Abmachungen zwischen den kleinen Leuten stiften zu können. Solche „Heilige“ sind die wahre Ursache der Unordnung. Das Abendland musste bis zum 19. Jahrhundert warten, um von Max Stirner diese Lehre zu hören. Wie lange wird es dauern, bis wir sie verstehen?
Es ist erstaunlich, dass weder der zeitliche noch der kulturelle Abstand uns daran hindern, die Botschaft der Philosophie heute zu verstehen. Die aktuelle Politik entspricht genau dem Gegenbild, das Laotse und Zhuangzi zum Weisen entworfen haben, der dem (rechten) Weg folgt: Sie meint, durch immer mehr Eingriffe in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben Ordnung, Sicherheit, Wohlstand, Frieden und eine gesunde Erde schaffen zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Dies ist das Wissen der Menschheit seit zweieinhalbtausend Jahren, im Westen wie im Osten. Wenn das Wissen nicht genutzt wird, dann darum, weil die Herrschenden sich nicht darum scheren. Ihnen muss das Handwerk gelegt werden. Sie sind die wahren Diebe, Räuber und Übeltäter.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.

