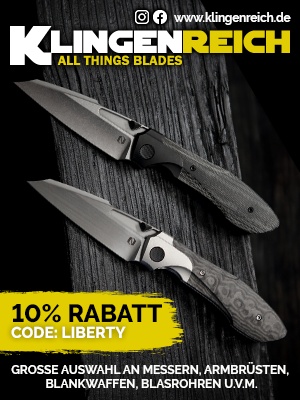Libertäre Philosophie – Teil 4: Wer zweimal in denselben Fluss steigt
Die Vorsokratiker

Zwar gilt Sokrates immer noch als der erste Philosoph des Abendlands, doch war er es definitiv nicht. Allerdings hat seine durch Platon gezeichnete Figur lange Zeit die Vorstellung von Philosophie geprägt, und alles, was es vor oder neben ihm an Denkern gegeben hat, wurde abschätzig als „Vorsokratiker“ zusammengefasst und abgetan. Die Überlieferung ihrer Schriften ist dementsprechend bruchstückhaft, meist nur in Form von Zitaten bei anderen philosophischen Autoren, die zum Umkreis entweder des Platonismus oder Aristotelismus gehörten (Aristoteles kommt in Folge 8 dieser Serie zum Zuge). Dabei befand sich unter den Vorsokratikern ein so bedeutender und geschichtlich auch prägender Kopf wie Pythagoras, der die Mathematik und Musiktheorie begründete und darum im Gedächtnis der Menschheit haften blieb.
Erst Hegel, Nietzsche und Heidegger haben im 19. und 20. Jahrhundert eine Ehrenrettung der Vorsokratiker eingeleitet. Da die Überlieferung aber wie gesagt recht bruchstückhaft ist, eignen sich diese Bruchstücke hervorragend dazu, das in sie hineinzuinterpretieren, was einem gerade gut gefällt.
Von den Vorsokratikern hat inzwischen kein anderer einen so guten Ruf wie Heraklit (um 520 bis um 460 vor Christus). Gern wird sein Sprüchlein fallen gelassen, niemand könne zweimal in denselben Fluss steigen, denn alles fließe und nichts bleibe. Platon und später Aristoteles bemühten sich vor allem darum, die gleichbleibende Struktur des Seins zu erfassen, der eine ausgehend von den Ideen, der andere von der Materie. Dinge mussten beim Namen genannt werden, Kategorien erhielten feste Definitionen, Logik und Mathematik halfen, die Welt zu ordnen und die Wahrnehmung zu kanalisieren.
Aber das widerspricht der Wahrnehmung. Dinge ändern sich. Manchmal langsam, manchmal schnell. Alles fließt, wie Heraklit sagte. Dinge verwandeln sich, manchmal sogar in ihr Gegenteil, plötzlich und ohne Vorwarnung. Die ordnende Struktur, die der Welt einen festen Rahmen gibt, ist eine Illusion. Sie ist ein Trost gegenüber der konkreten Erfahrung, dass nichts bleibt, wie es ist; eine Erfahrung, die oft genug erschreckt, wenn man sich es in der Welt eingerichtet hat. Vielleicht handelt es sich bei ihr um eine Art religiösen Trosts, vielleicht aber auch um eine böse Ideologie, wie wir am Beispiel Platons gesehen haben: Der ordnende Philosoph befindet sich nicht nur im offenkundigen Gegensatz zur Realität, sondern er will seine Ordnung auch der widerstrebenden Realität zum Trotz geltend machen – und da er den Dingen nicht befehlen kann, träumt er davon, die Menschen seiner Vision zu unterwerfen.
Auf der anderen Seite ist die Ansicht Heraklits freilich unpraktisch; denn sie verstößt ebenfalls gegen die Wahrnehmung. Sicherlich kann man zweimal in den gleichen Fluss baden gehen. Eine Variation seiner Flussmetapher zeigt eine mildere Form der Aussage, nämlich: Wer in denselben Fluss hinabsteige, dem ströme stets anderes Wasser zu. Das ist schon deutlich weniger provokativ. Hier gibt es ihn, denselben Fluss. Nur das Wasser tauscht sich aus. Und das ist sicherlich richtig. Wenn ich am nächsten Tag wieder baden gehe, ist das Wasser vom Tag vorher hinab- und neues, anderes Wasser nachgeflossen. Aber das schert mich nicht, denn es gleicht dem Wasser von gestern. Oder anders gesagt: Es schert mich nicht, sofern es dem Wasser von gestern gleicht oder ähnelt. Wenn kaltes oder schmutziges Wasser nachgeflossen ist, schmälert es meine Badefreuden oder verhindert sie ganz. Wir haben in der Diskussion noch mehrere andere feste Faktoren: Wir können das Beispiel nur deshalb diskutieren, weil wir unter Wasser etwas Bestimmtes verstehen. Das Gleiche gilt für den Fluss, den Fluss als allgemeines Abstraktum, aber auch für den konkreten Fluss, in dem ich bade. Natürlich könnte er seinen Lauf verändern, aber erfahrungsgemäß passiert das nicht über Nacht. Und selbst wenn er es tut (etwa bei einer Überschwemmung), spreche ich immer noch von diesem Fluss mit diesem Namen, der seinen Lauf verändert hat oder über die Ufer getreten ist. Wenn es beispielweise die Spree in Berlin ist, wird sie nicht über Nacht und vermutlich niemals zum Nil in Ägypten.
Obwohl im strengen Sinne kein Vorsokratiker, sondern ein Zeitgenosse Platons, führe ich hier noch Diogenes von Sinope (um 413 bis um 323 vor Christus) an, denn auch er forderte die Weltsicht des ordnenden Philosophen heraus, wenn auch auf einer ganz anderen Ebene als Heraklit. Schon unter antiken Autoren ist umstritten, ob er überhaupt etwas geschrieben habe. Von ihm sind jedenfalls nur Anekdoten überliefert. Die bekannteste ist seine Begegnung mit Alexander dem Großen. Alexander hatte von diesem Weisen gehört und darüber, dass er in Armut lebe. Er suchte ihn also auf, um ihm ein besseres Leben zu ermöglichen. In der Tat fand er Diogenes in einer Tonne lebend vor. So fragte Alexander Diogenes, was sich dieser von ihm wünsche. Diogenes soll lakonisch geantwortet haben: „Geh mir aus der Sonne“, denn er lebte nicht aus Not, vielmehr aus bewusster Entscheidung in Armut. (Was das betrifft, werden wir Diogenes dann bei den Stoikern wiederfinden.) Der Überlieferung zufolge hat Alexander dem Wunsch des Weisen mit den Worten entsprochen: „Wenn ich nicht Alexander wäre, wollte ich Diogenes sein.“ Eine größere Ehre für den exzentrischen Einsiedler ist wohl nicht denkbar.
In unserem Zusammenhang ist eine andere Anekdote bedeutsam. Platon hatte definiert, der Mensch sei ein federloses zweifüßiges Tier. Der Legende nach rupfte Diogenes einem Hahn die Federn aus – eine wahrlich tierquälerische Vorstellung – und warf ihn ihm und seinen Schülern mit den Worten vor die Füße, dies sei Platons Mensch. Zunächst kann man anmerken, dass Platons Definition ziemlich bescheuert war, was es leicht machte, sie entweder zu verhöhnen oder begrifflich auseinanderzunehmen. Vielleicht stand dahinter bei Platon der Versuch, eine besonders minimalistische Definition zu liefern, die auf komplexere Zusammenhänge nicht eingeht. Aber dies dahingestellt, der makabre Witz, den Diogenes sich erlaubte, funktioniert nur, wenn wir wissen, dass der gerupfte Hahn kein Mensch und der Mensch kein gerupfter Hahn ist. Das Äußerste, was Diogenes mit seiner Aktion belegen konnte, war, dass Platon eine mangelhafte Definition vorgelegt hatte; sie demonstrierte nicht, dass das philosophische Vorgehen, die Welt mit mehr oder weniger klugen Definitionen zu ordnen, ein sinnloses Unterfangen ist.
Die antike Auseinandersetzung, der Beef zwischen Platon und Diogenes (indirekt Heraklit), hat höchste aktuelle Brisanz. In der bisherigen Geschichte stand die Philosophie, die die Welt in einer statischen Ordnung fassen wollte, auf der Seite der Herrschenden, die sich als Sachwalter der objektiven Wahrheit sahen. Gegenwärtig aber ist die Heraklit-Diogenes-Sichtweise zur Herrschaft gekommen. Kategorien, Definitionen, ja die Logik selber wird als dem Fortschritt und der Menschlichkeit widerstreitend angesehen. Während früher der Sachzwang für die Legitimität der Herrschaft herhalten musste, weil sich aus ihm genau das ableiten ließ, was den jeweiligen Herrschaftsinteressen entsprach, ist es heute umgekehrt: Der Sachzwang ist das, was die Herrschenden daran hindert, ihre Interessen durchzusetzen. Sie leugnen den Sachzwang. Wer auf ihn rekurriert und dazu womöglich noch die Logik bemüht, ist konservativ und verhindert den Bau einer gerechten Gesellschaft.
Eine freiheitliche Perspektive muss beide Seiten der antiken Auseinandersetzung aufheben; aufheben im Hegel’schen Sinne: erhalten. Die Welt ist plastisch, veränderbar. Sie verändert sich ohne und mit unserem Zutun. Wenn sie sich ohne unser Zutun verändert, fordert das unsere Anpassungsfähigkeit heraus. Aber sie lässt sich auch durch unser Zutun verändern. Und in diesem Fall ist stets die Frage, wer über die Veränderung entscheidet. Vor allem aber haben die von uns initiierten Veränderungen wieder Konsequenzen, die wir nicht völlig unter unserer Kontrolle haben: Es gibt unerwartete und unerwünschte Nebenwirkungen, die dann erneut unsere Anpassungsfähigkeit herausfordern.
Bei allen Veränderungen ist die Erkenntnis der Konsequenzen und gegebenenfalls der unerwünschten Nebenwirkungen das zentrale Element: Hier kommen wir nicht aus ohne eine Erkenntnistheorie, die die Wirklichkeit der Wirklichkeit anerkennt. Sie muss uns dabei leiten, das Veränderliche und Unveränderliche, das Vermeidbare und das Unvermeidbare zu identifizieren. Sofern sie dazu beiträgt, ist sie dem Leben und der Freiheit nützlich, ansonsten macht sie sich zum nützlichen Idioten.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.