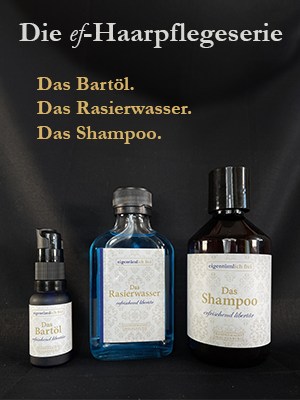Sexualität und Freiheit – Teil 11: Die Geständnisse des Fleisches
Michel Foucaults Irrtum

Die Annahme, die Geschichte der abendländischen Sexualmoral sei in der Moderne (16. bis 19. Jahrhundert) durch die Repression des Sprechens über Sexualität gekennzeichnet, wäre falsch. Mit dieser These schockierte Michel Foucault (1926–1984), ein hochangesehener Vertreter der damals sogenannten neuen französischen Philosophie, 1976 die linksliberale Öffentlichkeit. Wie so oft bei französischen Philosophen entpuppt sich die grandiose Geste entgegen dem Anschein als wenig radikal.
In einem auf sechs Bände projizierten Werk will Foucault zeigen, dass das Sprechen über Sexualität nicht tabuisiert wird, vielmehr wird über Sexualität gesprochen, jedoch das Sprechen über sie dient dazu, sie in gewisse Bahnen zu lenken. Das Reden über Sexualität ist zwanghaft darauf gerichtet, es zu unterbinden – aber das schon in der Zeit vor der Moderne, in der es keineswegs frei gewesen sei. Okay, das haben wir uns fast schon gedacht. Es handelt sich nicht um eine großartig neue Erkenntnis. Von dem angekündigten Werk sind nach dem ersten Band von 1976 mit acht Jahren Verspätung zu seinen Lebzeiten nur zwei weitere Bände erschienen, ein vierter 2019, 35 Jahre nach Foucaults Tod: „Die Geständnisse des Fleisches“. Titel des Gesamtwerks: „Sexualität und Wahrheit“. Den ursprünglichen Plan hatte Foucault vollständig über den Haufen geschmissen: Es ging nicht mehr um die Moderne, sondern um den Umbruch der Sexualmoral im Späthellenismus und Frühchristentum.
Der griechische und römische Hellenismus sah ebenso wie die jüdische Antike in der Sexualität eine natürliche Gewalt, der man fast durchgehend bejahend gegenüberstand. Die philosophischen und ärztlichen Auseinandersetzungen bezüglich der Sexualität drehten sich um die Frage der Selbstsorge. Es gab eine Bandbreite von Aussagen, die von einem lockeren Umgang bis hin zur kompletten Ablehnung sexueller Betätigungen reichten; die Ablehnung erfolgte jedoch nicht aus moralischen Gründen, sondern allein aufgrund der Behauptung, sexuelle Betätigungen seien selbstschädigend. Die letztere Position wurde von den Stoikern, die jede Form von Emotionalität und seelischer Aufgewühltheit geißelten, und einer Reihe römischer Ärzte vertreten. Foucault konzentriert sich auf den Stoizismus und die antisexuellen Ärzte in einer Weise, die einer Fälschung gleichkommt. Denn in der griechischen Antike spielte der Stoizismus keine gesellschaftlich prägende Rolle; in der römischen Antike wurde er zwar die beherrschende Philosophie, aber nicht in Bezug auf die Sexualität. Unter den Ärzten gab es einflussreiche Stimmen, die der sexuellen Enthaltsamkeit schwere Krankheiten zuschrieben; sie lässt Foucault schlicht nicht zu Worte kommen. Überhaupt unterlässt Foucault jede Untersuchung der Frage, welchen Einfluss ein von ihm analysierter Autor hatte.
Das frühe Christentum knüpfte an den sexualfeindlichen Diskurs des Stoizismus an, änderte den Gesichtspunkt jedoch in einem entscheidenden Punkt ab: Ging es den Stoikern bei der Enthaltsamkeit um das leibliche Wohl des Menschen im Diesseits, verkündeten die frühchristlichen Philosophen, nur die Keuschheit (Jungfräulichkeit, ein Begriff, der auch auf Männer angewandt wurde) sei dazu angetan, im Jenseits die Vereinigung mit Gott zu erfahren. Das Reden über Sexualität war im Frühchristentum omnipräsent, aber ausschließlich im negierenden Sinne: Weil Sexualität abgelehnt wurde, brauchten sexuelle Betätigungen nicht im Einzelnen Gegenstand der Untersuchung zu werden. Sexualität wurde tabuisiert. Dabei gestand man ein, dass diese Position widernatürlich sei. Sie ist widernatürlich (der Körper will Sexualität), sie ist antisozial (der Fortbestand der Gesellschaft braucht Nachwuchs) und sie ist verantwortungslos auf das eigene Seelenheil bezogen (verantwortungslos, weil der Nachwuchs familiäre Fürsorge braucht).
Dies änderte sich im vierten Jahrhundert. Die Jungfräulichkeit galt weiter als höchste Form der Gottesintimität, die Ehe wurde aber auch, obzwar nicht gleichrangig, als wertvoll angesehen: Es galt nämlich nun, die Gesellschaft der Zukunft durch die Zeugung und Aufzucht von Kindern möglich zu machen. Dieser Zweck der Ehe durfte allerdings christlich gesehen nicht als einziger Zweck gesetzt werden, denn dann wäre die Ehe von Maria und Josef ungültig gewesen. Die Mäßigung der Sexualität, ihre Begrenzung auf die Ehe, erklärten die christlichen Philosophen jetzt zum anderen Zweck der Ehe. Dabei blieb völlig unbeantwortet die Frage, aus welchem Grund diese Mäßigung und Begrenzung stattfinden solle. Sei’s drum. Da die Natürlichkeit des sexuellen Begehrens realistisch zugestanden wurde, mussten die christlichen Philosophen, so auch der heilige Augustinus, nun eine beide Partner befriedigende Sexualität in der Ehe zugestehen.
Am stärksten ausgebaut hat dies Argument Thomas von Aquin im Hochmittelalter. Die Prävention gegen Ehebruch besteht ihm zufolge darin, dass in der oder durch die Ehe sexuelle Befriedigung gewährleistet werde. Thomas ging so weit zu sagen, dass alle Gebote sexueller Enthaltung, wie zum Beispiel an hohen kirchlichen Feiertagen, außer Kraft gesetzt sind, wenn andernfalls Unkeuschheit drohe. Bei diesem Gedanken konnte er sich durchaus auf Formulierungen bei Augustinus stützen. Diesen Gedanken zugrunde gelegt, müsste es in der Ehe eingeschlossen sein, die eigenen sexuellen Bedürfnisse zu artikulieren, falls sie sich nicht unausgesprochen erfüllen. Müsste. Die katholische Sexualmoral hat sich diese Chance entgehen lassen und stattdessen auf die stillschweigende außereheliche Befriedigung der sexuellen Wünsche gesetzt. Augustinus ging so weit zu sagen, dass die Gesellschaft, würde man die Prostitution unterbinden, in Wollust versinken würde. Damit gab er beides zu, nämlich dass Sexualität eine nicht zu bändigende natürliche Kraft sei und dass die (christlich begrenzte) Ehe allein nicht ausreichen würde, ihre Wucht zu begrenzen.
Interessanterweise findet bei Foucault die Überlegung keinen Eingang, dass für Augustinus und seine Zeitgenossen die Ehe als Zugeständnis an die Weltlichkeit genau an dem Punkt notwendig wurde, an dem das Christentum den Status der Staatsreligion erreichte. Als Staatsreligion konnte das Christentum nicht mehr in der radikalen Weise gesellschafts- und lebensfeindlich sowie verantwortungslos bleiben, wie es mit Paulus begonnen hatte.
Wie ist es gelungen, der lebensfeindlichen Ideologie des Christentums im Kontext der – und als Zerstörung der – antiken Welt zum Sieg zu verhelfen? Gegen die Dekadenz, Ungerechtigkeit und Brutalität der Herrschenden verbindet sich der Widerstand seit jeher und bis heute mit der generalisierten Lebensfeindlichkeit einer Vorstellung der Reinheit im Sinne von Abwesenheit des Begehrens. Um eine solche Lebensfeindlichkeit gegen die Natur des Menschen durchzusetzen, bedarf es der Etablierung von Brutalität, die Ungerechtigkeit und schließlich auch Dekadenz unvermeidlich nach sich zieht. So beginnt der Kreislauf von Neuem, beispielsweise in der Reformation: Der Widerstand gegen die katholische Dekadenz brachte den Puritanismus hervor, der in der allgemeinen Zügellosigkeit seine Dialektik findet. Das ist der Kreislauf der Sklavenmoral, den Friedrich Nietzsche beschrieb: Die Sklaven rebellieren und siegen unvermeidlich, bringen damit aber die Sklavenmoral zur Herrschaft. Einen Ausbruch aus dem Kreislauf gewährt allein eine Lebensbejahung, wie sie von Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Ayn Rand gelehrt wurde, um drei miteinander völlig inkompatible Denker zu nennen.
Foucaults übergeordnete These, der Diskurs selber (und nicht die Institution der Herrschaft) sei es, der darüber wacht, dass der von ihm abgesteckte Rahmen nicht übertreten wird, ist ein Artefakt von Foucaults Methode, nämlich seinem selektiven Lesen. In Wirklichkeit (dieser Ausdruck sei hier keine Floskel, sondern mit tiefem Ernst gebraucht) ist der Diskurs vielfältiger, als Foucault es für seine These braucht. Die Lektüre von „Die Geständnisse des Fleisches“ macht mir diesen Irrtum im Denken Foucaults besonders deutlich: Indem er diejenigen antiken Ärzte ausklammert, die in einem Mangel an Sexualität den Ursprung von Krankheiten sahen, diejenigen Philosophen, die dem Stoizismus widersprachen und den Genuss priesen, sowie diejenigen christlichen Theologen, die Adam und Eva die sexuelle Lust im Paradies nicht ab-, sondern zusprachen, konstruiert er eine Homogenität des Diskurses.
Dennoch: Foucault erinnert daran, dass die Religion nicht die gesellschaftliche Funktion innehat, die Moral zu befördern, vielmehr übt die Religion die Funktion aus, die Macht zu pampern. Für diese Einsicht gebührt ihm der ewige Dank der Menschheit.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.