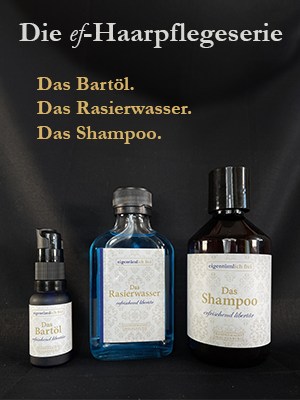Chance einer neuen Gesellschaftsordnung: Ist Anarchokapitalismus möglich?
Die Rückkehr zur Selbstverantwortung

Selbst wenn man sich darauf einigt, dass der Anarchokapitalismus zu einer Notwendigkeit geworden ist, stellt sich die Frage, ob eine solche Gesellschaftsordnung überhaupt möglich ist, denn auf den ersten Blick scheinen unüberwindbare Probleme das Gedeihen einer staatenlosen Gesellschaft zu verhindern. Libertarismus bedeutet eine Gesellschaft des Privatrechts. Private Unternehmen auf dem Markt erfüllen die traditionellen Funktionen des Staates. Eine Ordnung des Anarchokapitalismus ersetzt die hierarchische Koordination der staatlichen Aktivitäten durch horizontale Zusammenarbeit auf der Grundlage des freiwilligen Austauschs. Obwohl eine libertäre Ordnung in Bezug auf ihre Folgen einer Revolution gleichkommt, ist der Weg zu ihrer Schaffung nicht revolutionär. Der Weg zu einer anarchokapitalistischen Ordnung verläuft allmählich als ein fortlaufender Prozess der Privatisierungen. Beginnend mit dem Verkauf von halbstaatlichen Unternehmen und öffentlichen Versorgungsunternehmen, wird sich die Privatisierung Schritt für Schritt auf das Bildungs- und Gesundheitswesen erstrecken und auch die Sicherheit und das Justizsystem umfassen.
Häufige Einwände gegen den Anarchokapitalismus bezweifeln die Möglichkeit, staatliche Aktivitäten durch den privaten Sektor zu ersetzen. Es werden Fragen gestellt wie „Wenn es keinen Staat gibt, wer würde dann die Straßen bauen?“, „Wer würde sich um die Armen kümmern?“, „Wer würde für Bildung, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Recht sorgen?“ oder „Wenn es keinen Staat gibt, wer würde dann die Renten zahlen?“ Solche Fragen sind nicht das Ergebnis der Analyse, sondern der Gewohnheit. Wenn die Versorgung mit Socken und Unterwäsche in den Händen des Staates läge, würden die Menschen die gleichen Fragen zu Socken und Unterwäsche stellen. Übernimmt der Staat eine Tätigkeit, verdrängt er die private Versorgung. Dies führt zu dem paradoxen Ergebnis, dass staatliche Dienstleistungen umso unentbehrlicher erscheinen, je mehr Aktivitäten der Staat unter seine Kontrolle bringt.
Vor nicht allzu langer Zeit waren viele der Aktivitäten, die heute vom Staat ausgeführt werden, in privater Hand. Die Regierung hat diese Dienstleistungen nicht übernommen, weil der private Sektor versagt hat, sondern weil die Parteipolitiker in ihrem Streben nach Macht und deren Ausdehnung in den privaten Sektor eingegriffen haben. Wenn die Interventionsspirale einmal in Gang kommt, gibt es kein Ende: Je mehr der Staat befiehlt, desto mächtiger werden Politiker und Staatsfunktionäre. Je mehr die Marktwirtschaft schwindet, desto einfacher wird es für die Parteipolitiker, weitere Aktivitäten unter ihre Zuständigkeit zu bringen.
Wenn der Staat eine wirtschaftliche Aktivität übernimmt, nimmt die Knappheit nicht ab, sondern wächst. Daher erscheinen alle wichtigen Aktivitäten des Staates – sei es Bildung, Gesundheitswesen oder äußere und innere Sicherheit – immer als unterfinanziert und ausbaubedürftig. Aufgrund der künstlichen Verknappung verlangen die Wähler umso mehr von diesen Dienstleistungen, je mehr der Staat sie bereitstellt. Kein Parteipolitiker würde es wagen, diese Wünsche zu leugnen. Welcher Parteivertreter würde weniger Ausgaben für Bildung, Gesundheit und Sicherheit vorschlagen? Die Wähler merken nicht, dass sie in einer Falle sitzen. Sie sehen nicht, dass es neben dem Mangel an Effizienz auch ein Überangebot an staatlichen Dienstleistungen gibt. Sie verkennen, dass der Mangel nicht natürlich ist, sondern vom Staat selbst künstlich erzeugt wird. Deshalb helfen Mehrausgaben auch nicht. Wenn die Regierung auch noch so viel an Mitteln bereitstellt, nehmen die Mangelerscheinungen nicht ab.
Die Grenze für eine endlose Ausdehnung des Staates in Bezug auf die Ausgaben wäre die Budgetbeschränkung. Aber wenn der Staat an die finanzielle Grenze gestoßen ist, hört der Kontrollwahn nicht auf, sondern geht in anderen Bereichen weiter. Wenn die Staatsausgaben an ihre Grenzen stoßen und finanzielle Beschränkungen die Staatsausgaben einschränken, wendet sich der Staat der Kontrolle über die Aktivitäten zu, für die kein Geld ausgegeben werden muss. Je knapper der Staat bei Kasse ist, desto mehr dehnen sich die staatlichen Maßnahmen zur Verhaltenskontrolle aus. Es kann deshalb nicht verwundern, dass in den letzten Jahrzehnten Verhaltenssanktionen – was man essen und trinken darf, bis hin zu dem, was man sagen und nicht sagen darf – laufend zunehmen. Zuerst regulieren die Regierungen, was du in den Mund nehmen darfst, dann kontrolliert der Staat, was aus deinem Mund kommen darf.
Der moderne Parteienstaat enthält eine systemische Tendenz zur Ausdehnung. Obwohl die Steuern und Sozialausgaben immer mehr steigen, nimmt die öffentliche Verschuldung zu. Obwohl immer mehr für „soziale Zwecke“ ausgegeben wird, nehmen die sozialen Notlagen nicht ab, sondern vermehren sich. Obwohl der Staat über immer mehr Einnahmen verfügt und die Kreditaufnahme steigert, verlottert die Infrastruktur.
Im Anarchokapitalismus könnte das meiste, was der Staat an Dienstleistungen heute erbringt, auf einen Bruchteil des heutigen Volumens fallen. Die sogenannten „öffentlichen Dienstleistungen“ würden nicht nur besser und billiger werden, sondern es würde sich auch herausstellen, dass die Nachfrage nach Bildung, Gesundheitsversorgung, Verteidigung und innerer Sicherheit in einem freien Markt ganz anders aussehen würde als heute. Daher würde die Privatisierung vieler Aktivitäten, die jetzt unter staatlicher Autorität stehen, nicht nur zu einer Senkung der Kosten pro Einheit der Dienstleistungen, sondern auch zu einem Wegfall von Teilen des Volumens führen, da ein großer Teil der sogenannten „öffentlichen Güter“, die der Staat anbietet, eine nutzlose Verschwendung ist. In einer Privatrechtsgesellschaft würde nichts von den wirklichen Vorteilen von Bildung, Gesundheitsversorgung und Verteidigung verloren gehen, aber die Budgets für diese Maßnahmen würden auf einen Bruchteil ihrer derzeitigen Größe sinken, während die Qualität des Angebots zunähme. In einer freien Marktwirtschaft richtet sich das Angebot nicht nach den staatlichen Vorgaben, die Parteipolitiker festlegen, sondern nach den Wünschen und der Zahlungsbereitschaft der Marktteilnehmer.
Bezieht man den aufgeblähten Justiz- und Verwaltungsapparat in die Reduzierung der Staatstätigkeit mit ein, könnten die Staatsausgaben, die heute in den meisten Industrieländern fast fünfzig Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, auf den einstelligen Bereich sinken. Steuern und Abgaben könnten um neunzig Prozent sinken. Der Trend zu immer mehr Ausgaben, wie er heute im Gesundheitsbereich herrscht, würde sich umkehren, da der technologische Fortschritt nicht wie jetzt zu immer mehr Ausgaben führte, sondern sich die Nachfrage an der Abwägung von Kosten und Nutzen orientierte.
Anders als derzeit vorherrschend, ist die Privatisierung der Polizeifunktionen und der Justiz kein so großes Problem, wie gemeinhin angenommen wird. Privatisierung in diesem Bereich bedeutet, das zu erweitern, was heute schon geschieht. In vielen Ländern übersteigt die private Polizeiarbeit, zum Beispiel durch Sicherheitskräfte, bereits die Zahl der Polizeibeamten. Die private Erbringung von Justizdienstleistungen ist auf dem Vormarsch. Schiedsgerichte verzeichnen eine steigende Nachfrage, vor allem bei Dienstleistungen für grenzüberschreitende Dispute. Diese Trends werden sich fortsetzen, weil privater Schutz und Schiedsgerichtsbarkeit billiger und besser sind als die öffentliche Versorgung.
Um den Kern des Problems zu verstehen, muss man erkennen, dass die Ausweitung des Staates nicht durch den steigenden Bedarf der Bürger zustande kommt, sondern das Ergebnis des Parteienwettbewerbs ist. Die Parteien bieten spezifische Vorteile an und verteilen die Kosten auf die Gesamtheit. Der Wähler lässt sich täuschen, weil er glaubt, persönliche Vorteile zu erhalten, doch lässt er dabei außer Acht, dass alle anderen Wähler dies auch annehmen und entsprechend alle auch zahlen. Tatsächlich kostet den Wählern in ihrer Gesamtheit das System mehr, als es ohne Staat der Fall wäre, denn das durch diesen Prozess hervorgerufene staatliche Angebot ist nicht nur teurer, als es das privat erbrachte wäre, sondern auch qualitativ schlechter.
Anarchokapitalismus bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Rückkehr zu einer der menschlichen Natur angemessenen Gesellschaftsordnung der Selbstverantwortung als Bedingung der Freiheit. Unnatürlich und antihuman ist das gegenwärtige System. Im Parteienstaat verbünden sich einzelne zu einer Art Gang, Partei genannt, mit dem Ziel, die Macht im Staat zu erringen, um dann der Bevölkerung den Parteiwillen aufzuzwingen. Anarchokapitalismus repräsentiert das Weltbild einer freien Gesellschaftsordnung. Freiwillige Tauschbeziehungen leiten das menschliche Handeln. Diesem Weltbild steht die hierarchische Organisation der Gesellschaft entgegen, in der gewaltsame Herrschaftsbeziehungen dominieren.
Antony P. Mueller: „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie. Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik“ (KDP 2021)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.