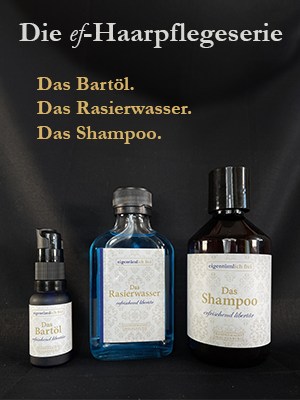Libertäre Philosophie – Teil 36: Ludwig von Mises: Marx findet zu sich selber
Zur Verteidigung des Kapitalismus

Schon im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte die Philosophie sich gegen Individualismus, Liberalismus und Kapitalismus gewandt, massiv geschah dies dann im 20. Jahrhundert. Selbst Philosophen, die eigentlich gar nicht mit Gesellschaft, Politik oder Wirtschaft befasst waren, mussten irgendwie zu verstehen geben, dass es eines ordnenden, starken Staats bedürfte, um Wirtschaft und Gesellschaft rational zum Vorteil aller zu organisieren. Die verbliebenen liberalen Restpolitiker hatten mit kolonialistischen, militaristischen und nationalistischen Kräften einen Pakt geschlossen, und dies ungenießbare Gemisch fand zwar oft die Zustimmung der Herrscher oder der Mehrheit der Wähler, war aber jedem denkenden Menschen zuwider. Dennoch ließ der Kapitalismus sich nicht totkriegen – bis heute nicht. Wie ist diese Konstellation zu erklären?
Ludwig von Mises (1881–1973) fand die Antwort: Kapitalismus, verstanden als das wirtschaftliche Verhältnis, das aus der freiwilligen Interaktion von Menschen hervorgeht, ist keine politische Einrichtung, die sich nach dem Belieben von Herrschenden richtet. Er ergibt sich daraus, dass Menschen handeln. Selbst unter den eingeschränktesten Bedingungen (wie zum Beispiel denen eines Lagers) werden die Menschen, soweit sie überhaupt einen Handlungsspielraum haben, versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen – und im gesellschaftlichen Zusammenwirken bedeutet dies, dass jeder das, was er meint, am besten entbehren zu können, gegen etwas eintauscht, dessen er mehr bedarf und das jemand anderes im Tausch hergibt. Das, was in Relation zur Nachfrage seltener angeboten wird, wird mehr kosten als etwas, das in Relation zur Nachfrage häufiger vorkommt. Ob diese Kosten im direkten Tausch – Gut gegen Gut, Gut gegen Dienstleistung, Dienstleistung gegen Dienstleistung – oder im indirekten Tausch mit einem gemeinsam akzeptierten Tauschmittel vor sich geht, macht keinen Unterschied. Der Wert einer Sache oder einer Leistung bemisst sich niemals nach etwas anderem als der Wertschätzung im unmittelbaren Tauschvorgang. Kritiker haben diese Subjektivität des Wertes im Tauschvorgang auf dem Markt bemängelt und einen objektiven Maßstab gefordert, so sollte zum Beispiel eine Sache, deren Herstellung mehr Ressourcen verbraucht als eine andere Sache, auch mehr wert sein, ebenso wie eine Sache, die mehr Arbeitszeit erheischt als eine andere Sache. Solche angeblich objektiven Wertmaßstäbe lassen sich, wenn überhaupt, nur durch den Einsatz von brutaler Gewalt durchsetzen: Sie bevormunden die Handelnden und zwingen ihnen diesen Wertmaßstab, der nicht ihr eigener ist, auf. Aber selbst die brutalste Gewalt hält den Vorgang nicht auf, dass Menschen versuchen werden, ihren jeweils eigenen Wertmaßstab in irgendeiner Weise doch noch zu realisieren, das heißt, es kommt zu informellen, grauen oder schwarzen Märkten.
Während in der Situation eines freien Handelns sich für alle Beteiligten stets die unter den gegebenen Umständen bestmöglichen Ergebnisse ergeben, ist dies in der Situation des durch Gewalteinwirkung beschränkten Handelns nicht mehr der Fall. Im Gewaltverhältnis wird, anders als im Tauschverhältnis, die Seite desjenigen, der Gewalt ausübt, mehr erhalten, als sie es im freien Tauschverhältnis erreichen könnte. Bei einem Raub ist dies ganz offensichtlich: Der Räuber nimmt ein Gut, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Dennoch ist auch der Raub nicht „kostenlos“: Der Räuber muss planen, er muss den Raub ausführen, gegebenenfalls mit Widerstand rechnen und vor allem eine mögliche Strafe fürchten. Der Beraubte aber hat von diesen Kosten nichts.
Die Aussicht, ein eigenes Bedürfnis auf Kosten eines anderen ohne dessen Zustimmung befriedigen zu können, ist der Motor der Kriminalität. Niemand würde das bestreiten. Aber der gleiche Mechanismus greift auch bei politischer Gewalt: Der Eingriff in das Geschehen des freien Tausches ist bei politischer Gewalt zwar komplexer als im Fall der Kriminalität, doch der Motor ist der gleiche – etwas erreichen können, das im freien Tauschverhältnis und mit Zustimmung aller Beteiligter nicht zustande kommt.
An diesem Punkt wird die allgemeine Handlungstheorie des Ludwig von Mises – die über die Grenzen der Standard-Ökonomik weit hinausgeht und eine ganze Gesellschaftstheorie begründet – zur Herrschaftskritik, und die Verbindung zu Marx (Teil 26) leuchtet sofort ein: Was Marx kritisierte, war die Ideologie der Herrschenden, die durch die Herrschaft ihren Schnitt machen, aber sie als das Allgemeinwohl verkaufen. Das Gemisch, das aus von feudalen Zwängen befreiten Märkten und fortbestehender politischer Herrschaft entsteht, war es, was Marx „Kapitalismus“ nannte, nicht der reine Markt. Marx mag mit einer romantischen Vorstellung einer harmonischen Gemeinschaft, die sich ohne Tauschverhältnisse organisiere, gestartet sein; zunehmend wurde ihm jedoch klar, dass der Kapitalismus und nur der Kapitalismus in der Lage ist, für alle mehr zu produzieren, als zur unmittelbaren Subsistenz benötigt wird.
Im Hinblick auf die Ideologie- oder Herrschaftskritik gibt es überhaupt keinen Dissens zwischen Marx und von Mises. Marx wurde überdies immer klarer, dass es einen objektiven Wertmaßstab, wie es die Ökonomik der (meisten) klassischen Liberalen annahm, nicht geben kann. Mit der subjektiven Wertlehre löste Ludwig von Mises das Marx’sche Problem, an dem Marx selber gescheitert war. Allerdings hätte von Mises gut daran getan, die Dialektik nicht ganz zu verwerfen, wie er es als (dogmatischer) Kantianer (Teil 22) tat. Denn dass sich aus der Vielzahl der subjektiven Wertschätzungen für ein Gut ein objektiver einheitlicher Marktpreis ergibt, das ist ein dialektischer Vorgang. Es war durchaus undialektisch, dass Marx meinte, in der Verwandlung der Vielzahl der „Gebrauchswerte“ (sein Ausdruck für subjektive Wertschätzungen) in einen objektiven „Tauschwert“ (sein Ausdruck für Preis) gehe jeder Gebrauchswert im Tauschwert verloren. Zwar mag meine Wertschätzung für ein Gut, das ich erwerbe, höher liegen als sein Tauschwert (ich würde auch mehr für es bezahlen), aber dadurch geht der Gebrauchswert für mich nicht verloren – er ist im Sinne Hegels (Teil 23) „aufgehoben“, er ist im Tauschwert enthalten, ohne dass ihm der Tauschwert exakt entspricht.
Das Ludwig von Mises Marx vehement und pauschal ablehnte, schwächt seine Theorie. Eine Synthese würde die Sache der Freiheit stärken. Noch bedauerlicher ist allerdings, dass Ludwig von Mises es zeitlebens versäumte, sich mit dem Anarchismus auseinanderzusetzen, in dem er nur eine militante Abart des Kommunismus sah. Trotz seines theoretischen Individualismus neigte von Mises leider zu Pauschalurteilen, ohne die von ihm kritisierten Autoren genauer in Augenschein zu nehmen. So hätte er, wenn er jemals einen Blick in Werk von Proudhon (Teil 24) geworfen hätte, vieles für ihn Bemerkenswertes finden können, etwa Proudhons Kritik an staatlichen Interventionen in die Wirtschaft, seine Skepsis gegen zentralstaatlich-demokratische Machtzusammenballung und seinen Nachdruck auf regionale Selbstverwaltung.
Mit Ludwig von Mises schließe ich – unhistorisch – diesen Streifzug durch die Philosophie unter der Fragestellung des Verhältnisses von Denken und Macht (im Sinne von Herrschaft). Philosophie macht Herrschaft fraglich: Damit allein ist sie bereits subversiv. Die Philosophie kann der Herrschaft nicht von wirklichem Nutzen sein. Folgerichtig sind alle Herrschaftssysteme der Philosophie gegenüber vorsichtig. Gern wollen sie das Denken unter ihre Knute stellen, aber immer geht es ihnen durch die Lappen. Die Philosophen zu Herrschern zu machen, wie Platon (Teil 3) es wollte, ist aus doppeltem Grund unmöglich: Da Herrschaft sich auf einen ebenso unverbrüchlichen wie unvernünftigen Anspruch stützt, andere Menschen ihrer Willkür zu unterwerfen, stellt sie schon ihrer Definition nach einen Widerspruch zum kritischen Denken dar. Man kann nur entweder Philosoph oder Herrscher sein. Und da das Wesen der Philosophie das kritische Fragen ist – das Paradigma des Sokrates (Teil 1) –, müsste sich der Philosoph als Herrscher ständig selber infrage stellen und damit seinen Herrschaftsanspruch untergraben.
Nächste Woche folgt dann zum Ende der Serie noch eine Schlussbetrachtung.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.