Wider die hysterische Propaganda: Warum Maschinen wahrscheinlich nie Bewusstsein entwickeln werden
… und den Menschen nicht überflüssig machen können
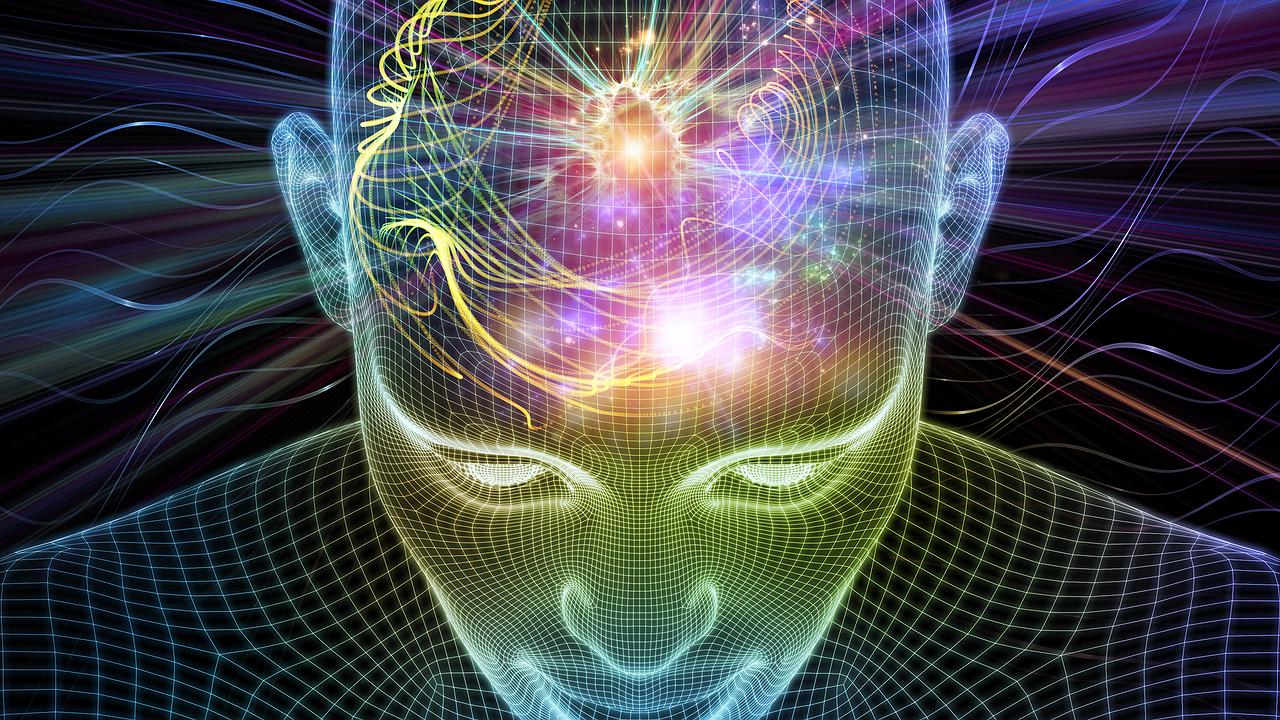
Derzeit kursieren mal wieder viele Beiträge in den sozialen Netzwerken, ebenso eine Flut an Videos wie zum Beispiel auf Youtube, die in alarmistischer Manier vor einer „Machtübernahme“ durch Maschinen und Künstliche Intelligenz warnen. Oder davor, die KI könne bald ein eigenes Bewusstsein entwickeln und dadurch die Menschheit überflüssig machen.
Ganz ruhig. Denn es gibt Gründe, anzunehmen, dass dieses Szenario sehr unwahrscheinlich sein dürfte. Wobei es auf die Perspektive ankommt, genauer: wie man sich dem Phänomen namens Bewusstsein beziehungsweise bewusstem Denken und Intelligenz nähert.
Nimmt man die konventionelle, immer noch als wissenschaftliche „Orthodoxie“ geltende Position des materialistischen Reduktionismus ein, könnte man versucht sein, Maschinen die Fähigkeit zur Entwicklung von Bewusstsein zuzuschreiben. Dieser Lehrmeinung zufolge wären Bewusstsein und Intelligenz nur die Folge einer bestimmten materiellen Organisation des Gehirns, mit anderen Worten: Bewusstsein sei vollständig auf das materielle „Substrat“ des Gehirns reduzibel, also auf die Art und Weise der Verschaltung von Nervenzellen in unserem Denkorgan – mehr nicht. Um es noch mal umzuformulieren: Bewusstsein ist nicht mehr als die Summe seiner materiellen Teile. Aus diesem materialistisch-mechanistischen Blickwinkel könne man es dementsprechend simulieren beziehungsweise durch eine geeignete Anordnung elektronischer Bauteile, zum Beispiel in einem Computer, und mit einer entsprechenden Software, die dann auf dieser Hardware läuft, hervorbringen.
Einer der angesehensten Wissenschaftler der Welt, der Mathematiker und theoretische Physiker Roger Penrose, zu dessen berühmtesten Schülern der Astrophysiker Stephen Hawking gehörte, ist gänzlich anderer Meinung. Die Argumente, die er im Laufe seiner jahrzehntelangen Forschungen zu Phänomenen wie Bewusstsein und Intelligenz entwickelte, sind mitunter sehr kompliziert und alles andere als „im Vorbeigehen“ zu verstehen, daher werde ich mich hier auf die Kernpunkte konzentrieren und sie so leicht verständlich wie möglich ausdrücken.
Penrose bezieht sich in seinem Buch „Shadows of the Mind. A Search for the missing Science of Consciousness“ unter anderem auf das Gödel’sche Unvollständigkeitstheorem, um zu beweisen, warum Bewusstsein etwas sein muss, das sich nicht algorithmisch berechnen lässt. Er stützt sich dabei auch auf neuere Erkenntnisse aus der Quantenphysik und argumentiert, dass unser Bewusstsein möglicherweise aus einer Quelle stammen könnte, die sich eben nicht auf materielle Substrate reduzieren lässt. Penrose entwickelte zusammen mit dem Anästhesisten Stuart Hameroff das sogenannte „Penrose-Hameroff-Modell“, demzufolge es sich – der Dieter-Thomas-Heck’sche „Schnelldurchlauf“ sei mir bitte verziehen – bei Bewusstsein um eine Art „Grenzphänomen“ handeln könnte, das an der Grenze zwischen dem Quantenraum und dem klassischen physikalischen Raum entsteht oder, wie man quantenphysikalisch auch sagen könnte: an der Grenze zwischen „Nichtlokalität“ und „Lokalität“. Der sogenannte „Kollaps der Wellenfunktion“ – aus dem Zustand reiner Wahrscheinlichkeit, des Probabilistischen – in einen spezifischen, wohldefinierten findet laut diesem Modell in mikroskopisch kleinen zylindrischen Röhrchen statt, den Mikrotubuli, die sich in großer Zahl in den Nervenzellen des Gehirns finden. Diesen Prozess aber, so Penrose, könne man nicht einfach maschinell „nachbauen“, um dadurch Bewusstsein zu schaffen.
Natürlich könnte man auch – was Penrose in besagtem Buch kurz streift – auf die seit Urzeiten geführten Diskussionen über das eigentliche „Wesen“ der natürlichen Welt zurückgreifen, also auf die Frage, ob das Universum und – naturphilosophisch gesprochen die Existenz – generell ein „geistiges“ Phänomen sei oder seine Ursachen darin habe.
Der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Max Planck fasste seine Einstellung dazu einmal in die Worte: „Ich betrachte das Bewusstsein als grundlegend. Ich betrachte die Materie als vom Bewusstsein abgeleitet. Wir können nicht hinter das Bewusstsein kommen. Alles, worüber wir sprechen, alles, was wir als existierend betrachten, setzt Bewusstsein voraus“ (aus einem Interview mit J. W. N. Sullivan, „The Observer“, 25. Januar 1931, Seite 17).
Oder man könnte sich auf den Medizin-Nobelpreisträger George Wald berufen: „Es ist der Geist, der ein physisches Universum geschaffen hat, das Leben hervorbringt, und so entstehen schließlich Geschöpfe, die wissen und schaffen: Wesen, die Wissenschaft, Kunst und Technologie schaffen. In ihnen beginnt das Universum, sich selbst zu erkennen“ („Life and Mind in the Universe“, „International Journal of Quantum Chemistry“: Quantum Biology Symposium 1 I, 1–15, 1984).
Kurz, man könnte also die materialistisch-reduktionistische und die pan- beziehungsweise kosmopsychistische Position bis zum Umfallen miteinander streiten lassen. Der bisherige Erkenntnisstand erlaubt es nicht, hier ein abschließendes Urteil zu fällen – auch wenn ein Penrose fachlich ins extreme Detail geht und seine Argumentationsführung sehr plausibel erscheint.
Für diejenigen, die mit Gödels Unvollständigkeitstheorem nicht vertraut sind, zunächst die einfache umgangssprachliche Fassung: Ein System wie zum Beispiel die Mathematik ist mehr als eine willkürliche Schöpfung des Menschen. Sie ist etwas Absolutes, das nur entdeckt, aber nicht erfunden werden kann. Mit anderen Worten: Sie geht über das „System Mensch“ hinaus. Etwas präziser: „Es wird oft argumentiert, dass Gödel gezeigt habe, dass auch die Arithmetik eine Sache der willkürlichen Wahl sei, wobei ein beliebiger Satz von konsistenten Axiomen so gut ist wie jeder andere. Dies ist jedoch eine völlig irreführende Interpretation dessen, was Gödel uns gezeigt hat. Er hat uns gelehrt, dass der Begriff eines formalen axiomatischen Systems allein nicht ausreicht, um auch nur die grundlegendsten mathematischen Konzepte zu erfassen. Anstatt zu zeigen, dass die Mathematik (insbesondere die Arithmetik) ein willkürliches Unterfangen sei, dessen Richtung von der Laune des Menschen bestimmt würde, hat Gödel gezeigt, dass sie etwas Absolutes ist, das entdeckt und nicht erfunden werden muss“ (Penrose, „Shadows of the Mind“, Seite 110-111).
Noch etwas allgemeiner formuliert: „Der Kernpunkt von Gödels Argument für unsere Zwecke ist, dass es uns zeigt, wie wir über einen gegebenen Satz von Rechenregeln, die wir für solide halten, hinausgehen und eine weitere, nicht in diesen Regeln enthaltene Regel erhalten können, die wir ebenfalls für solide halten müssen, nämlich die Regel, die die Konsistenz der ursprünglichen Regeln bestätigt“ (Ebda., Seite 94).
Dies könnte man auch so formulieren: Ein System lässt sich nicht allein aus der systemischen „Horizontalen“, also mit seinen eigenen Mitteln, vollständig begründen. Es gibt eine „vertikale“ Komponente dahingehend, dass es etwas außer- oder „oberhalb“ des Systems geben muss, um die „innere Logik“ beziehungsweise Konsistenz zu beweisen. Deshalb glaubt Penrose, dass Computer niemals „echtes“ Bewusstsein und auch keine echte Intelligenz entwickeln können, wie man sie im Menschen finden kann.
Wie bereits erwähnt, geht das Penrose/Hameroff-Modell aber davon aus, dass Bewusstsein ein an oder aus der „Grenzfläche“ zwischen Quanten- und klassischem physikalischen Raum hervorgehendes Phänomen sein könnte – und an dieser Stelle könnte man zumindest spekulieren, ob Quantencomputer, die ja eine ähnliche „Schnittstelle“ zum Quantenraum besitzen (Kurzform: Ein QuBit wird durch ein klassisches „Prüf-Bit“ ausgelesen), gerade deshalb möglicherweise doch zur Entwicklung desselben oder zumindest eines ähnlichen Phänomens fähig sein könnten – erst recht dann, wenn sie mit den Mitteln der Quantenkommunikation, an denen fleißig geforscht wird und die aufgrund des Verschränkungseffektes zeitverzögerungslose Kommunikation unabhängig von der Entfernung ermöglichen, in großem Maßstab vernetzt werden. Das SciFi-Genre hat ein solches Szenario ja schon öfter durchgespielt. (Man denke an Streifen wie „Terminator 2“ von James Cameron, in dem ein militärisches System namens „SkyNet“ ein Eigenbewusstsein entwickelte und sich gegen seine menschlichen Schöpfer wendete.)
Wie dem auch sei: Überzogene hysterische Warnungen und Szenarien, wie sie momentan kursieren und der Menschheit nur noch sehr wenig Zeit geben, sind nicht nur völlig verfrüht, sondern entbehren erst mal jeder Beweisgrundlage. Bislang machen Maschinen nur das, worauf sie programmiert werden – und mehr nicht. Mag die KI auch noch so clever programmiert sein, reagiert sie dennoch nur auf Eingaben menschlicher User. Echte Autonomie, mithin proaktives bewusstes Denken wie im Menschen, kann zu diesem Zeitpunkt nur simuliert werden. Solche Simulationen mögen durchaus sehr überzeugend wirken, berechtigen aber nicht zu apokalyptischen Horrorszenarien.
Bis nächste Woche.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.

