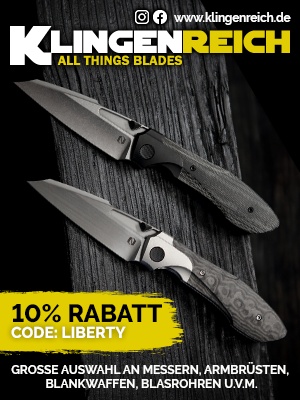Schweiz: Zu Unrecht gescholtener Föderalismus
Von seinen unbestreitbaren Vorteilen

Mit ihren 20 Kantonen, sechs Halbkantonen und 2.205 Gemeinden für ihre nur 8,9 Millionen Einwohner erscheint die Schweiz als unübersichtliches politisches Mosaik. New York City zählt eine ähnlich große Bevölkerung, ist jedoch lediglich in sechs Bezirke unterteilt. Die Schweiz steht in puncto Staatsumfang und -kosten trotzdem wesentlich besser da als die meisten zentralisierten Staaten – eine Ausnahme bilden hier Stadtstaaten wie Singapur. So belaufen sich die allgemeinen Staatsausgaben in der Schweiz auf 34 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während sie 41 Prozent in Großbritannien, 44 Prozent in Deutschland, 48 Prozent in Österreich oder 56 Prozent in Frankreich betragen. Auch das winzige Fürstentum Liechtenstein (38.000 Einwohner, unterteilt in elf Gemeinden) sticht mit einem äußerst kleinen Staatssektor (20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den gesamten öffentlichen Sektor inklusive Sozialversicherungen) und hohen Lebensstandards heraus. Dies zeigt: In Sachen Politik und Staat gibt es keine Skaleneffekte. Größer heißt nicht effizienter.
Dasselbe Bild findet man bei der Anzahl der Staatsangestellten in der allgemeinen Verwaltung vor: Die Schweiz steht mit zehn Prozent der gesamten Beschäftigung wesentlich besser da als die USA (15 Prozent), Österreich (17 Prozent), Frankreich (22 Prozent) oder Schweden (29 Prozent). Sie hat außerdem den kleinsten Zentralstaat, mit nur acht Prozent der Staatsangestellten, während es in den USA 18 Prozent, in Großbritannien 58 Prozent und in Irland gar 90 Prozent sind.
Die Idee der politischen Zentralisation hat dieselbe oberflächliche Anziehungskraft wie ein Monopol: Wettbewerb sei demnach verschwenderisch, weil er viele ähnliche Funktionen dupliziere. Es verhält sich aber beim inländischen zwischenstaatlichen Wettbewerb genauso wie bei der internationalen Zersplitterung der politischen Macht: Vielfalt führt zu institutioneller Innovation, zu einem besseren Verhältnis zwischen den Bedürfnissen und Präferenzen der Bürger einerseits und staatlichen Leistungen andererseits. Außerdem fördert die drohende Abstimmung mit den Füßen über kleinere Distanzen die Achtung vor individuellen Rechten und das Wirtschaftswachstum.
So war etwa der kleine Halbkanton Obwalden die erste Gebietskörperschaft in Kontinentalwesteuropa, die eine proportionale Besteuerung einführte – nachdem es lange Zeit ein Schlusslicht in Bezug auf die Wirtschaftsleistung und Abwanderung war. Tendenziell haben positive Entwicklungen wie Steuersenkungen oder die Abschaffung der Erbschaftssteuer für Erben in direkter Linie dazu geführt, dass sich regional eine geringere steuerliche Gefräßigkeit ausbreiten konnte. Dies hat Kapitalakkumulation, Investitionen, Wirtschaftswachstum und Wohlstand für alle (im Sinne von mehr Beschäftigungsoptionen und höherer Kaufkraft) längerfristig begünstigt.
Tatsächlich erlaubt der politische Wettbewerb das Experimentieren, das Vergleichen und das Nachahmen von guten Lösungen. So wurde auch die Schuldenbremse, die auf Bundesebene seit dem Inkrafttreten 2003 eine Erfolgsgeschichte wurde, zuerst in manchen Kantonen eingeführt, bis die Idee ihren Weg zum Zentralstaat fand. Verschiedene Wettbewerbsfähigkeitsrankings und weitere Indikatoren, die die Vorteile von regulatorischer und steuerlicher Zurückhaltung belegen, untermauern die Vorteile der Vielfalt. Sie fördern auch einen gesunden lokalen Patriotismus, der vor allem auf Attraktivität und Lebensqualität gerichtet ist.
Der Föderalismus sollte allerdings nicht einfach mit kantonalem Etatismus und einem unreflektierten „Kantönligeist“ gleichgesetzt werden: Etatismus und Protektionismus – ob auf zentraler oder gliedstaatlicher Ebene – sind immer schädlich. Dies, weil sie sich effizienteren marktwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Lösungen sowie der freien Konkurrenz widersetzen, was beispielsweise im Gesundheitswesen beobachtet werden kann. Wenn also der Föderalismus etwas vorschnell als „reformhemmend“ bezeichnet wird, sollten vorerst die wirklichen Zusammenhänge geklärt werden: Sind Bundesgesetze im Spiel? Wie gestalten sich die Finanzierungsflüsse zwischen den Staatsebenen? Was ist die Rolle des öffentlichen Sektors? Welche Reformen wären tatsächlich wirksam?
Mit Föderalismus in der begrenzten staatlichen Sphäre ist vor allem die starke Subsidiarität des Zentralstaats, die Wettbewerbsfähigkeit der Gliedstaaten sowie die Zerstreuung und Trennung der Staatsgewalten gemeint. Damit diese Faktoren auch zu guten Ergebnissen führen, soll eine Parallelität zwischen Entscheidung, Finanzierung und Betroffenheit gelten. Eine solche Ausgangslage mündet in eine dynamische föderale Ordnung, die nicht einfach nur Strukturen bewahrt, sondern in erster Linie im Sinne eines begrenzten Staats den Bürgerfreiheiten, inklusive der Wirtschaftsfreiheit, dienlich ist. Quersubventionen und Umverteilungen zwischen den Staatsebenen oder zwischen den Gliedstaaten (Finanzausgleich, Aufgabenverflechtungen) sollten dagegen vermieden werden.
Der Föderalismus entsteht in der Regel organisch, indem historisch zusammengewachsene Gebietskörperschaften gewisse Kompetenzen von unten nach oben delegieren. Er ist daher das Gegenteil einer vom Zentralstaat ausgehenden vielschichtigen Verwaltungsstruktur, in der die Gliedstaaten lediglich die Entscheide der Zentrale umzusetzen haben. Das Doppelmehr von Kantonen und Stimmenden bei Bundesverfassungsänderungen ist aus diesem Blickwinkel beispielsweise ein wichtiges Instrument gegen ungewollte Machtballung der Zentralgewalt.
Um den Föderalismus und seine positiven Auswirkungen zu stärken, soll prioritär der Bund begrenzt werden. Die direkte Bundessteuer, die eine Anomalie im System darstellt und als provisorische Wehrsteuer eingeführt wurde, sollte endlich ersatzlos abgeschafft werden, sowohl für Privatpersonen (Einkommenssteuer) als auch für Unternehmen (Gewinnsteuer). Dies würde die Verzettelung des Zentralstaats in Gebieten wie etwa im Sozialen und in der Kultur eindämmen. Die Entpolitisierung und Entstaatlichung der aktuellen zentralstaatlichen Sozialversicherungen, die erst unter dem nationalkollektivistischen Geist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen konnten, würden zudem neue wirtschaftliche Impulse auslösen. Die Aufgliederung der sozialen Sicherung auf kantonaler Ebene oder in den Gemeinden – wenn sich die Privatinitiative nicht sofort durchsetzt – würde zumindest die Fehlanreize, die bürokratischen Automatismen und die Reformunfähigkeit, die mit der zentralen Steuerung entstanden sind, im Systemwettbewerb der Gliedstaaten teilweise korrigieren.
In dieser Hinsicht ist auch eine Vermeidung einer Kartellierung zwischen den Kantonen in immer mehr Bereichen wichtig. Hier sind die Regierungs- und Direktorenkonferenzen und die weiteren interkantonalen Institutionen zur Zurückhaltung aufgefordert. Obwohl Koordination und Austausch sicherlich auch sinnvoll sein können, sollten die Handlungsfreiheit und die institutionelle Innovation gerade nicht durch interkantonale Vereinbarungen und Konkordate unterbunden werden. Gleichzeitig sollen Harmonisierungen, die rein praktischer Natur sind, nicht untersagt werden: Schließlich ist es für alle Bürger von Vorteil, dass die Schweiz beispielsweise einheitliche Maß- und Gewichtssysteme und keine unterschiedlichen Zeitzonen kennt und dass auf dem ganzen Gebiet Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit gilt.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.