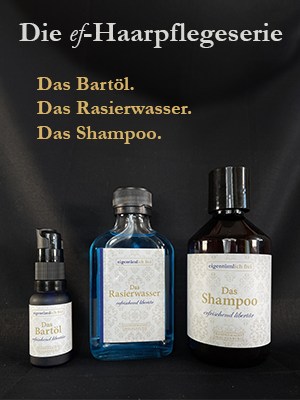Schweiz: Wäre Altersarmut ohne staatliches Rentensystem die Norm?
Was dabei übersehen wird

Die AHV wurde 1948 eingeführt und wird seither nicht nur von den Sozialdemokraten als „wichtigste Errungenschaft der Schweiz“ gefeiert. Doch die AHV war nicht immer so unangefochten wie heute: Noch 1931 lehnten 60,3 Prozent der Stimmbürger die Einführung des auf dem Umlageverfahren basierenden Sozialwerks ab. Dies, weil sie die Idee der Eigenverantwortung, der die Schweiz schon damals ihren relativ hohen Wohlstand zu verdanken hatte, unterminiert. Erst nach den zerrüttenden Eindrücken eines Weltkriegs wurde – nachdem der Bundesrat von seinen Sonderrechten Gebrauch gemacht hatte – die unnötige Verstaatlichung der Altersvorsorge von einer Volksmehrheit beschlossen.
Aus Sicht einer eigenverantwortlichen Zivilgesellschaft ist die Einführung der AHV alles andere als eine „Errungenschaft“. Vielmehr muss die Annahme der Vorlage als ein bedauerlicher und schwerwiegender gesellschaftlicher Rückschritt betrachtet werden.
Zwar scheint die AHV auf den ersten Blick ihren Zweck zu erfüllen und vielen älteren Menschen ein Einkommen zu sichern. Genau dieser Zweck hätte nach Ende der Kriegswirtschaft jedoch ebenso und deutlich besser durch einen marktwirtschaftlichen Prozess aus Arbeit, Ersparnis, Investition und gezielte freiwillige Solidarität erreicht werden können. Anders als die AHV wäre ein marktwirtschaftliches Verfahren der individuellen Vorsorge auch nicht als Ponzi-System aufgegleist worden, das eine ständige finanzielle Schieflage nach sich zieht, die persönliche Verantwortung schwächt und kaum fähig zur Anpassung an demographische Herausforderungen ist.
Die AHV wird zu Unrecht als „Versicherung“ bezeichnet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Rentenbezieher „Beiträge“ entrichtet haben, durch die sie einen Rentenanspruch erhalten. Die erste Generation von AHV-Beziehern etwa erhielt eine Rente, ohne ins System überhaupt oder genügend eingezahlt zu haben. Sie profitierten – wie in einem typischen Schneeballsystem – auf Kosten künftiger Einzahler. Genau diese unverdienten Einkommen verhalfen möglicherweise der Einführung der AHV zur entsprechenden Popularität.
Die AHV-Lohnabzüge sind keine Einzahlungen auf ein persönliches AHV-Konto, wie es der offizielle AHV-Ausweis und die persönliche AHV-Nummer suggerieren. Es handelt sich dabei schlicht um eine Steuer, die unmittelbar an die Rentenbezieher ausbezahlt wird. Weil die AHV keine Lohn- oder Einkommensobergrenze kennt, ist der AHV-Abzug korrekt betrachtet eine zusätzlich proportionale Einkommenssteuer von rund zehn Prozent. Ab einem Einkommen von 85.000 Franken ist die AHV aufgrund der begrenzten Maximalrente zudem auch formell eine reine Steuer.
Die Lebenserwartung ist seit Einführung der AHV erfreulicherweise von 68 auf 83 Jahre gestiegen. Das gesetzliche Referenzalter für den Rentenbezug ist dagegen bei 64 beziehungsweise 65 Jahren steckengeblieben. Die „Beiträge“ reichen längst nicht mehr aus. Heute muss die AHV unentwegt durch die Mehrwertsteuer und weitere Steuern subventioniert werden, um die Auszahlungsansprüche abdecken und das Schneeballsystem weiter am Leben erhalten zu können. Inzwischen kostet die AHV jedes Jahr über 45 Milliarden Franken, wovon mehr als ein Viertel über die Einnahmen aus der AHV-Steuer hinaus aus anderen Steuerquellen finanziert werden muss.
Die mit der AHV verbundene Steuerbelastung hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Wachstumspotenzial der Schweizer Wirtschaft mit der Zeit bedeutend geschwächt wurde. Der oft gehörte Einwand, dass die AHV-Renten durch die Bezieher „konsumiert“ würden und daher auch belebend für die Wirtschaft seien, ist selbstverständlich haltlos. AHV-Renten reizen zum Konsum auf Kosten anderer Menschen an, die andernfalls dieses Geld ebenfalls konsumiert oder investiert hätten. Die AHV-Renten stellen lediglich eine Umverteilung dar und schaffen keinen wirtschaftlichen Mehrwert.
Die AHV ist somit eine ständige Quelle der Ungerechtigkeit geworden. Sie beruht seit Anbeginn auf politischer Willkür, nicht auf versicherungsmathematischen Prinzipien. Es ist kein Zufall, dass die AHV nach zehn „Revisionen“ bereits mehrere Steuererhöhungen hinter sich hat: Die Spielregeln müssen ständig geändert werden. Tatsache bleibt, dass der Staat Leistungen verspricht, die er ohne eigentumsverletzende Belastungen der Steuerzahler nicht finanzieren kann. Künftige Steuerzahler werden nur Renten beziehen können, die in keinem angemessenen Verhältnis zu dem stehen, was sie in Form von Lohnabzügen und Steuern selbst zu entrichten hatten.
Viele AHV-Anhänger gehen davon aus, dass man den Menschen mit der Wegbesteuerung in der produktiven Phase ihres Lebens und der Auszahlung im Rentenalter einen Dienst erweise. Es handelt sich diesem Verständnis nach bei den Bürgern um unmündige Wesen, die allesamt nicht zur eigenverantwortlichen Vorsorge fähig sind. Das ist ein gewaltiges Zerrbild der Realität. Die meisten beweisen Tag für Tag, dass sie durchaus Eigenverantwortung auch unter der Bedingung zukünftiger Unsicherheit wahrnehmen können, indem sie etwa langfristige Lebensversicherungen und Hypotheken abschließen, freiwillig via dritte Säule fürs Alter sparen und ihr Geld umsichtig investieren.
Verfechter des staatlichen AHV-Umlageverfahrens behaupten, dass es in einem liberalen System der Altersvorsorge keine Garantie gebe, dass Menschen genügend aufs Alter hin sparen würden und dass ihnen bei Altersarmut Hilfe zukomme. Diese Argumentationsweise ist problematisch, weil sie impliziert, dass es in einem verpolitisierten und kollektivierten Schneeballsystem wie der AHV eine Art Garantie gäbe, wonach jeder und jedem im Alter genügend Ressourcen zugeteilt würden. Dem ist mitnichten so. Das AHV-System ist nicht nachhaltig, weil es die Grundlagen seiner eigenen Finanzierung – die produktive Wirtschaft – unterhöhlt.
Um die Renten-Ansprüche befriedigen zu können, ist ein immer gewichtigerer Anstieg der Steuerlast nötig – eine äußerst problematische Entwicklung, weil damit Anreize gesetzt werden, die die Wirtschaft über die Zeit immer mehr erlahmen lassen. Irgendwann kommt unweigerlich der Moment, an dem nicht mehr genügend Mittel zusammenkommen, um die Ansprüche der Renten-Empfänger abgelten zu können. Die AHV verheddert sich zunehmend in einer Spirale der Überbesteuerung und impliziten Überschuldung. Wer davon ausgeht, die AHV sei eine Art Garantie gegen Altersarmut, gibt sich Illusionen hin.
Eine Abkehr vom Umlageverfahren wäre zum Vorteil aller. Der Übergang von einem Umlage- zu einem Kapitaldeckungsverfahren würde Eigentumserwerb und individuelle Vermögensbildung begünstigen und zudem aufgrund der echten Kapitalbildung das Wirtschaftswachstum wesentlich beschleunigen.
Optimal wäre ein Altersvorsorgesystem, in dem die Bürger aus freien Stücken sparen und sich gegen Großrisiken – auch im Alter – versichern könnten. Nur ein solches System der individuellen Freiheit ist mit der Ethik der Eigenverantwortung kompatibel.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.