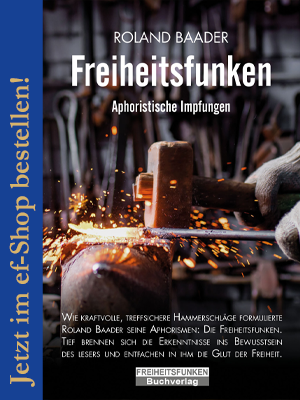Sexualität und Freiheit – Teil 3: Frei durch Disziplin?
Die konservative Illusion

Nur wer seine Impulse, Gefühle und Bedürfnisse „im Griff“, also unter Kontrolle habe, könne frei sei. Die Rede ist von Selbstbeherrschung (was für ein verräterischer Ausdruck!). In vielen Kulturen stellt es über Jahrtausende hinweg das Ideal des erwachsenen Menschen dar, dass er zur Impuls- und Selbstkontrolle fähig sei. Ein solcher Mensch unterwirft sich nicht seinen eigenen inneren Trieben, ist aber auch nicht durch die äußeren Gegebenheiten bestimmt: Letztere werden rational und angemessen eingeschätzt und nach dieser Einschätzung erfolgt die Handlung, die ein solcher Mensch vor sich selbst, vor den Mitmenschen und vor Gott verantworten kann. Er lässt sich durch die äußeren Umstände nicht zu übereilten und letztlich schädlichen Reaktionen aus dem Bauch heraus hinreißen, sondern wägt die sich eröffnenden Möglichkeiten besonnen ab.
Eine Gesellschaft, in der die Menschen die Impuls- und Selbstkontrolle verlernen oder nie beigebracht bekommen, ist dekadent. Da unkontrolliertes Handeln gesellschaftliche Probleme hervorruft, wird die innere durch die äußere Kontrolle ersetzt. Gesellschaftliche Institutionen übernehmen diese Kontrolle. Der Einzelne wird zunehmend seiner Verantwortung enthoben: Wenn er etwas Sozial- oder Eigenschädliches tut, setzen Beschwichtigungen, Erklärungen und Entschuldigungen ein, wie etwa die schwere Kindheit des Täters oder seine Schuldunfähigkeit aufgrund eines (freiwillig und sich selbst zugefügten) Rausches. Nicht der Täter ist schuld und wird zur Rechenschaft gezogen, sondern den zuständigen Kontrollorganen spricht die Öffentlichkeit Versagen zu. Sie haben ihre Aufgabe des Schutzes der Gesellschaft und der Kontrolle schädlichen Verhaltens nicht erfüllt. Unter diese Kontrolle fällt nicht nur der Schutz der Gesellschaft, sondern auch der Schutz des Einzelnen vor sich selbst. Er darf sich nicht einmal mehr selbst Schaden zufügen. Falls er hierzu eine Neigung zeigt, muss er daran gehindert werden, wenn nötig mit Zwangseinweisung in eine geschlossene Anstalt. Dies stellt keine Strafe dar, sondern Vorsorge. Prävention avanciert somit zur ersten Bürgerpflicht: Für die Kontrollorgane gilt die Maßgabe, vorab die Neigung zu einer gesellschaftlich abgelehnten Handlung zu erkennen und deren Ausführung zu verhindern. Dabei entsteht eine Kontrollgesellschaft, in der zwar niemand mehr sich selbst kontrollieren muss, aber jeder einer kompletten Kontrolle durch die gesellschaftlichen Apparate unterworfen ist. Niemand ist mehr frei.
Während der erste Absatz ganz klar in der kultur- und wertekonservativen Ecke des politischen Spektrums zu verorten wäre – heute meist mit der nichtssagenden und irreführenden Richtungsbezeichnung „rechts“ identifiziert –, trifft dies für den zweiten Teil nur bedingt zu: Die Analyse der Herausbildung einer Kontrollgesellschaft geht auf Philosophen (Soziologen?) wie Gilles Deleuze und Michel Foucault zurück, die man zumindest lange Zeit eher „links“ verortete; bisweilen ändert sich das, wenn die gesellschaftlichen Kontrollapparate für sich die angeblich moralisch überlegene Richtungsbezeichnung „links“ beanspruchen und jeden Widerspruch als „rechts“ stigmatisieren – wobei die Vokabeln „links“ und „rechts“ offensichtlich, außer als Richtungsbezeichnung, mit keinerlei Inhalt verbunden sind. Sie sind politisch wertlos und vielleicht halten sie sich gerade deshalb so hartnäckig: Man kann sie je nach dem Stand der Tagesaktien mit Sinn aufladen und dann als moralinsaure Waffe einsetzen.
Um ein erstes Problem im Ideal eines selbstkontrollierten Menschen zu erkennen, bedarf es keiner Psychoanalyse. Dass das rationale Handeln kein Ziel hat, wenn es von dem körperlichen Wohlergehen abgekoppelt wird, kann man schon bei dem mittelalterlichen Philosophen Thomas von Aquin nachlesen. Nehmen wir ein so unverfängliches Beispiel wie die Nahrungsaufnahme. Die rein rationale Herangehensweise sieht von Appetit, Gier, Vergnügen und Völlerei ab und betrachtet nur den Aspekt, dass die Nahrungsaufnahme der Erhaltung des Körpers diene. Doch wie weiß ich, was der Erhaltung meines Körpers dient, wenn ich nicht meinen Körper befrage? Natürlich kann ich, anstatt meinen eigenen Körper zu befragen, die Nahrungsaufnahme an den diätetischen Regeln orientieren, die andere formulieren – aber wenn ich das tue, werde ich schnell merken, dass mein Körper nicht denen der anderen gleicht; zudem handele ich dann eben nicht selbst-, sondern dezidiert fremdbestimmt, was nicht dem Ideal der selbstbeherrschten (selbstkontrollierten) Ich-Stärke entspricht.
Mehr noch: Wenn ich mir beim Essen keine Lebenslust erlaube, beginne ich mich zu fragen, wozu ich den Körper denn erhalten solle? Diese heikle Frage verschärft sich noch, wenn wir von dem scheinbar unverfänglichen Beispiel der Nahrungsaufnahme zum Thema Sexualität übergehen. Auch hier ist es durchaus möglich – und entspricht der Vorstellung so mancher Religionen –, sie auf ihren rein reproduktiven Zweck zu reduzieren und jede Lustorientierung als Abweichung von der Vernunft zu geißeln. Das kennen wir aus unserer christlichen Tradition, doch auch bereits der griechische Philosoph Diogenes von Sinope verkündete, er wolle lieber sterben als Lust empfinden. Womit er sich natürlich selber widerlegte: Etwas lieber zu wollen als etwas anderes ist eben eine Lustempfindung und keine rationale Entscheidung. Thomas von Aquin wies die übliche christliche Argumentation, die Lust sei als widervernünftig zur Sexualität erst nach dem Sündenfall hinzugetreten, zurück, indem er bemerkte, dass Sexualität beim Menschen natürlicherweise nicht wie bei anderen Tieren auf die Zeit der Fruchtbarkeit der Frau eingeschränkt sei. Dafür erkannte er einen Grund: Der Sinn sei es, eine innige Verbindung der Gatten zu erzeugen, die notwendig sei, um die Aufzucht des Nachwuchses zu sichern. Die Gattenwahl lässt sich ebenfalls an angebliche Vernunftkriterien wie Einkommen oder soziale Stellung binden (etwas, das Thomas von Aquin nicht empfahl), aber da landen wir, wie bezüglich des Themas Essen, erneut bei der Tatsache, dass ein lustloses Tun tendenziell eher unterlassen wird.
Die Sorge, dass die Fixierung auf die Rationalität die Lebenslust aussterben lasse, ist aber übertrieben. Und damit sind wir bei dem zweiten Problem, welches das Ideal des selbstkontrollierten, rein vernünftig agierenden Menschen aufwirft, ein Problem, das zwar von alters her bekannt ist, aber von der Psychoanalyse besonders hervorgehoben wurde. Die Lebenslust ist nicht totzukriegen, durch keine Moral, durch keine Repression. Zum Beispiel: Man heiratet zwar nach Vernunftgründen wie der Mehrung des Familienbesitzes oder es ist einem verboten, sich scheiden zu lassen – aber die Menschen haben Affären. Sie finden immer einen Ausweg und beschreiten ihn sogar dann, wenn die Todesstrafe droht. Diese Umgehungstendenz (wie der Gestaltpsychologe Kurt Lewin es nannte) ist so allgemein und allgemein bekannt, dass niemand sie bezweifeln kann. Die traditionelle Moral verbucht sie allerdings unter Verfehlung, unter die Vorstellung, der Mensch tendiere natürlicherweise zum Bösen, und sagt, den Apostel Paulus zitierend, achselzuckend: Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Um dem willigen und guten Geist auf die Sprünge zu helfen, gegen das widerstrebende und böse Fleisch zu obsiegen, bedarf es nun der gesellschaftlichen Kontrolle durch Instanzen der Repression. So gelangen wir unter der Hand mit dem Ideal des selbstkontrollierten Menschen dann doch ebenfalls bei zur Kontrollgesellschaft, wenn auch in einem ganz anderen theoretisch-moralischen Rahmen.
Was die Psychoanalyse der unbestreitbaren und bekannten Umgehungstendenz – oder, psychoanalytisch ausgedrückt: der Wiederkehr des Verdrängten – hinzufügte, war die Beobachtung, dass die Bedürfnisse, Impulse, Gefühle unter der äußeren moralischen und inneren charakterlichen Repression zwar nicht verschwinden, aber deformiert oder pervertiert werden. Sie sind nicht an sich böse und antisozial, sondern werden es vielmehr durch die Repression, die uns vor ihrer antisozialen Bosheit schützen soll. Der Kampf der gesellschaftlichen Moral und Kontrollinstanzen gegen die Lebenslust führt nach Sigmund Freud zu einem „Unbehagen in der Kultur“, das sich letztlich kulturzerstörerisch äußern wird.
Gegenüber der Dekadenz, die, wie gezeigt, letztlich zur Herausbildung einer Kontrollgesellschaft und der Negierung der individuellen Selbstbestimmung führt, die Rückkehr zu den alten Normen des selbstkontrollierten Charakters zu propagieren, ist die Illusion der Konservativen: Selbst wenn eine solche Rückkehr möglich wäre (was zweifelhaft ist), hätte sie keine befreiende Wirkung, sondern mündete in abermaliger Repression. Kein erstrebenswertes Ziel.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.