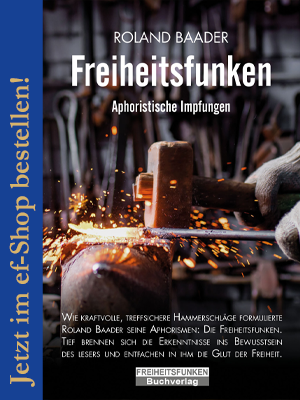Fortschrittsglaube und Konstruktivismus: Linke Mythen: Geschichte wird gemacht, es geht voran!
Über linke Hybris und Grandiosität
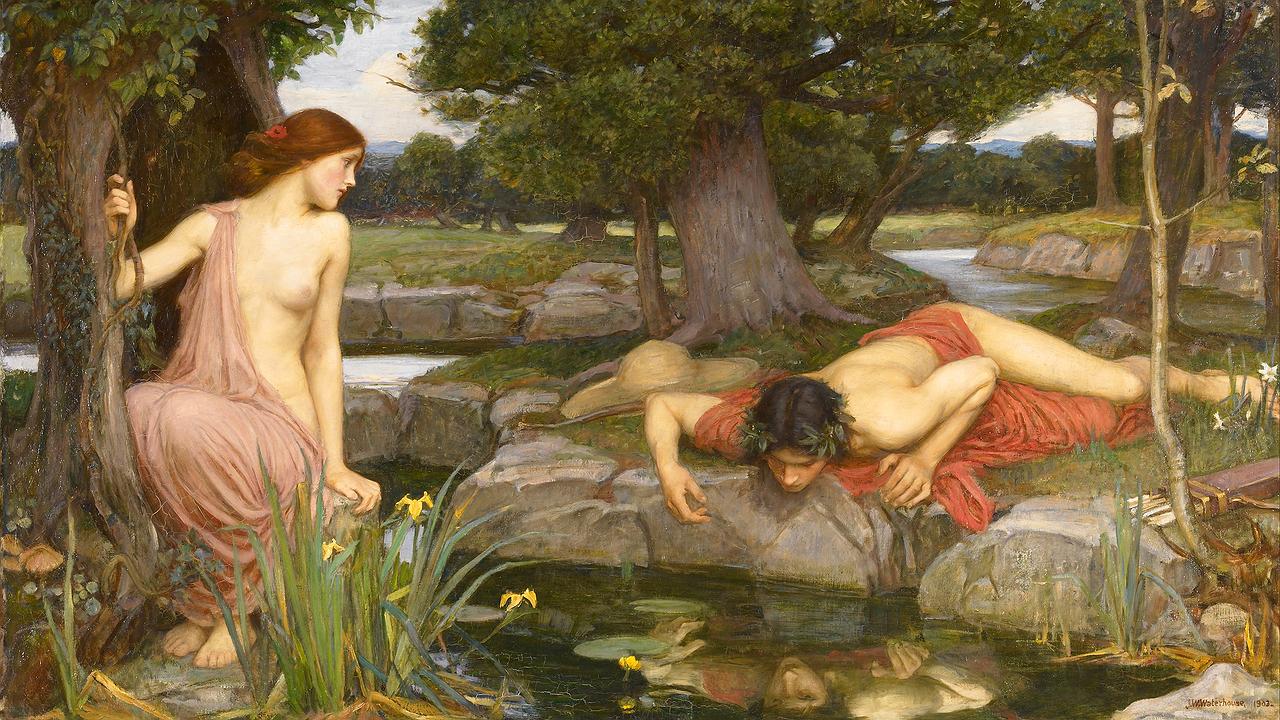
Der Titel dieser Kolumne ist einem Song von Fehlfarben (1980) entnommen. (1) Sein Text ist klar ironisch und nimmt den Fortschrittsglauben seiner Zeit aufs Korn, welcher in den 1960er und 1970er Jahren sehr ausgeprägt und mit der Vorstellung verbunden war, die Menschen seien in der Lage, ihr Schicksal zu gestalten, indem sie den weiteren Verlauf der Geschichte intentional bestimmen. Dies bringt der Titel sehr gut auf den Punkt.
Fortschrittsglaube ist links und geht auf Marx und Hegel zurück. Marx stellte Hegel, der die Geschichte als die „dialektische“ Entfaltung eines „Weltgeistes“ interpretierte und damit eine gesetzmäßige Entwicklung unterstellte, „vom Kopf auf die Füße“. Nicht der Geist treibe die gesetzmäßige Entwicklung der Geschichte voran, sondern die materielle Basis der Gesellschaft: „Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein“ (Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859). Den Grundgedanken, dass der Verlauf der Geschichte gesetzmäßig erfolge und somit immer auf ein Ziel hin fortschreite, übernahm er somit von Hegel. Die Entwicklung vom Urkommunismus zur Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus zum Kapitalismus zum Sozialismus zum Kommunismus sei gesetzmäßig, nur die konkreten Erscheinungsweisen unterliegen Rahmenbedingungen aus einem komplexen, widerspruchsgetriebenen („dialektischen“) Entwicklungsprozess.
Die Unhaltbarkeit dieser Vorstellung hat Karl Popper (2), der diese Denkweise „Historizismus“ nennt, wie folgt begründet: Es handelt sich um eine Kategorienverwechslung. In der Natur gelten zeitunabhängige, universelle Gesetze. In der Gesellschaft gibt es aber nur situationsabhängige Tendenzen und Handlungszusammenhänge, keine Naturgesetze. Da der Verlauf der Geschichte von menschlichem Wissen abhängig ist und zukünftiges Wissen definitionsgemäß nicht vorhanden sein kann, ist der Verlauf der Geschichte unvorhersagbar. Es gibt keine historischen Kausalgesetze.
Wie aber kann ein marxistischer Linker behaupten, Geschichte würde „gemacht“, wenn sie doch seiner Ansicht nach naturgesetzlich verlaufe? Nun, das kann er logisch betrachtet nicht, aber das hat die Linke nie ernst genommen. Lenin fand es ja auch möglich, vom Feudalismus direkt in den Sozialismus überzugehen. Und Antonio Gramsci überzeugte die Linken dann endgültig, dass der Klassenkampf ein Kulturkampf sei, also auf dem Feld des Geistes ausgeführt werde. Mit einem kleinen Trick gelang es ihm, sich trotzdem als Marxisten zu bezeichnen: Die materielle Basis bestimme nicht einseitig den geistigen Überbau, sondern beide Sphären bedingten sich gegenseitig, stünden in einem „dialektischen“ Verhältnis zueinander. Linke lösen logische Widersprüche immer mit „Dialektik“ auf.
Damit war der Weg frei zu einer zentralen Position der heutigen Linken: Wirklich alles ist machbar, wenn es nur gelingt, unsere Art, wie wir die Dinge betrachten, zu ändern. Dann ist es möglich, nicht nur zwei Geschlechter, sondern ein ganzes Spektrum von Geschlechtern zu sehen. Dann ist es möglich, Wahrheit nicht mehr als etwas anzusehen, das zutrifft oder nicht zutrifft, sondern es kann jede gesellschaftliche Gruppe ihre eigene Wahrheit haben, die Außenstehende prinzipiell nicht beurteilen können. Wer das bezweifelt, werde zu Recht vom Diskurs ausgeschlossen oder gar ökonomisch vernichtet, weil die vorherige Behauptung unumstößlich wahr sei (ganz sicher haben sie für diesen logischen Widerspruch eine „dialektische“ Begründung). Insbesondere durch die Gestaltung der Sprache könne man das Weltbild der Menschen „machen“.
Die Vorstellung, der Mensch könne Kraft seines Geistes seine Zukunft willkürlich gestalten, ist wesentlich älter als Gramscis „Gefängnishefte“. Friedrich August von Hayek nennt diese Vorstellung „Konstruktivismus“ und führt sie auf die französische Aufklärung (Descartes 17. Jahrhundert, Rousseau 18. Jahrhundert) zurück. „Der Konstruktivist glaubt, dass er mit Hilfe der Vernunft alle sozialen Institutionen so entwerfen könne, wie man eine Maschine konstruiert“ (3). So wie wir immer komplexere Maschinen bauen können, so könnten wir auch immer komplexere Formen sozialen Zusammenlebens entwerfen und installieren.
Dahinter steht eine falsche Vorstellung von Vernunft. Etwas zu tun setzt immer das Wissen voraus, welches man benötigt, um es zu tun. Vernunft ist also immer durch Wissen eingeschränkt. Ich kann eine komplexe Maschine nur bauen, wenn ich von allen relevanten Naturgesetzen und ihrer sinnvollen technischen Nutzung weiß. In einer komplexen Gesellschaft gibt es aber erstens keine Naturgesetze (s. o.) und zweitens keinen Ort, weder in einem einzelnen Menschen noch in einem Planungsgremium, wo das gesamte Wissen zusammenkommt, das in einer komplexen Gesellschaft nötig wäre, um sie erfolgreich zu „konstruieren“. Wissen ist über Milliarden von Menschen verteilt. Der Glaube, dennoch über alles relevante Wissen zu verfügen, nennt von Hayek „Anmaßung von Wissen“. Eine Vernunft, die ihre Begrenzungen nicht erkennt, ist eine „Anmaßung von Vernunft“.
Der handelnde Mensch weiß nur im Ausnahmefall, welchen Regeln er in seinem Handeln folgt, weil diese biologisch oder kulturell überliefert sind: „Der Mensch kennt gewiß nicht alle die Regeln, die sein Handeln leiten, in dem Sinn, daß er sie in Worte zu fassen vermöchte. Zumindest in primitiven menschlichen Gesellschaften ist, kaum weniger als in Tiergesellschaften, die Struktur des sozialen Lebens durch Verhaltensregeln festgelegt, die nur dadurch in Erscheinung treten, daß sie tatsächlich befolgt werden. Erst wenn die Unterschiede zwischen den einzelnen Intellekten ein erhebliches Ausmaß annehmen, wird es nötig, diese Regeln in einer Form auszudrücken, in der sie mitgeteilt und explizit gelehrt werden können, so daß man abweichendes Verhalten korrigieren sowie Meinungsverschiedenheiten über richtiges Verhalten beilegen kann. Obwohl der Mensch nie ohne Gesetze existierte, die er befolgte, lebte er natürlich hunderttausende Jahre lang ohne Gesetze, die er in dem Sinne »gekannt« hätte, daß er sie hätte in Worte fassen können“ (4).
Dass auch heute, wo wir viele Regeln explizieren, die meisten immer noch unbewusst sind, erkannte schon Freud („Wir sind nicht Herr im eigenen Haus“) und dies wird von der Neurowissenschaft bestätigt. Wir sind Produkte unserer biologischen und kulturellen Evolution, unsere Lebensverhältnisse sind nicht „gemacht“, sondern, wie von Hayek es ausdrückt, das Ergebnis „spontaner Ordnung“. Ein hervorzuhebendes Beispiel spontaner Ordnung ist der Markt (den Linke ebenfalls stets als gemacht missverstehen – ein weiterer „linker Mythos“, der aber nur ein Spezialfall des Konstruktivismus ist).
Aber wenn sowohl Individuen als auch ihre sozialen Verhältnisse nicht gemacht sind, dann wird auch Geschichte nicht gemacht. Und dann gibt es auch keinen Fortschritt in dem Sinne, dass die Entwicklung auf ein vorher feststehendes Ziel zuliefe. Evolution hat kein Ziel, Evolution ist einfach nur ein anderes Wort für Veränderung.
Ein konstruktivistisch denkender Mensch hat ein grandioses, die eigenen Möglichkeiten überschätzendes Selbstbild und neigt unweigerlich zu moralischer Hybris. Da aber sein Vorhaben aufgrund der menschlichen Natur unmöglich ist, fehlinterpretiert er die sich ergebenden Probleme – konsequent in seinem Weltbild verbleibend – als intentional motivierten Widerstand, der bekämpft werden muss. Deshalb führt konstruktivistischer Rationalismus notwendigerweise zu Unterdrückung und Knechtschaft. Freiheit ist nicht, zu tun, was man will. Freiheit ist die Abwesenheit von willkürlichem Zwang.
Quellen:
(1) https://genius.com/Fehlfarben-ein-jahr-es-geht-voran-lyrics
(2) Karl Popper, Das Elend des Historizismus, Mohr 1987
(3) F. A. von Hayek: Die Anmaßung von Wissen, Mohr Siebeck 1996
(4) F. A. von Hayek: Recht, Gesetz und Freiheit. Mohr Siebeck 2003 (Originalausgabe 1973), S. 45f
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.