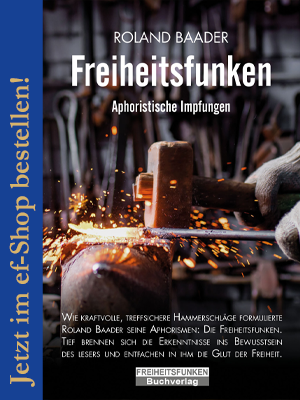Krieg und Frieden – Teil 9: Jede Seite ist die falsche
Was mich der Vietnamkrieg lehrte

Der Protest gegen den Vietnamkrieg prägte im Westen die Generation der in Europa so genannten 1968er. In den USA begann der Massenprotest bereits Anfang der 1960er Jahre.
Mit Vietnamkrieg wird verkürzt jene Phase des postkolonialen Kriegs in Indochina bezeichnet, während der die USA als Schutzmacht von Südvietnam diesem Staat gegen die Aggression von Nordvietnam und der von Nordvietnam installierten Guerilla-Organisation Vietkong beistanden. Die Teilung Vietnams in einen kommunistischen Norden und einen autokratischen Süden war das Ergebnis des Befreiungskampfes gegen sowohl den französischen als auch den japanischen Kolonialismus. Doch Frankreich sah sich infolge seiner verheerenden Niederlagen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in der Lage, Südvietnam militärisch zu stabilisieren, und hier sprangen die USA ein, die in Südvietnam wie in Westdeutschland einen Frontstaat gegen den ihrer Einschätzung nach expansiven Kommunismus der UdSSR sahen.
Südvietnam war, was die Mannstärke ihrer Armee betrifft, dem Norden plus dem Vietkong doppelt überlegen, ebenso in puncto Ausrüstung. Doch die USA hausten in Südvietnam, wie es arrogante Imperialisten eben tun, ohne Sinn und Verstand. Sie stürzten Regierungen und installierten neue Machthaber im Monatstakt, einer unfähiger als der andere. Die Bevölkerung kündigte die Loyalität auf, die Armee war demoralisiert, die USA mussten ab Mitte der 1960er Jahre zusätzlich zu ihren Militärberatern immer mehr Truppen entsenden.
Zehn Jahre vorher hatte der verlustreiche Koreakrieg stattgefunden, in dem es den USA gelungen war, Südkorea gegenüber Nordkorea standhalten zu lassen. Für die amerikanischen Bürger stellte sich der Koreakrieg nur in Form von Särgen dar, die heimkehrten, und zurückkommenden Soldaten, die schwer traumatisiert waren. Kaum einer hatte Verständnis für diesen Krieg in einer Region, mit der niemand eine Verbundenheit fühlte. „We lost Davy in the Korean War and I still don’t know what for“, heißt es in dem 1971 publizierten Country-Song „Hello in There“ von John Prine, den Joan Baez berühmt gemacht hat. Dennoch gab es gegen den Koreakrieg keinen nennenswerten Widerstand seitens der Bevölkerung der USA. Dies änderte sich mit der Eskalation in Vietnam. Die nachwachsende Generation wollte sich nicht verheizen lassen, ihre Eltern wollten die Kinder für keinen Krieg hingeben, der ihnen nichts bedeutete.
Der Protest gegen den Vietnamkrieg in den USA selber konstituierte sich zunächst nicht aus Sympathisanten der Kommunisten der UdSSR oder der VR China. Gemeinsam unterstützten sie Nordvietnam, obwohl aus den ideologisch Verbündeten zunehmend realpolitische Konkurrenten geworden waren. Der amerikanische Protest gegen den Vietnamkrieg speiste sich aus der Überzeugung von Liberalen (im europäischen Sinne) und Konservativen (im amerikanischen Sinne), Pazifisten und Anarchisten, dass es nicht Aufgabe der USA sein könne und dürfe, überall auf der Erde für Frieden und Freiheit zu sorgen. Diese sinnwidrig Isolationismus genannte Überzeugung war in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg unter den Bürgern der USA verbreitet, wurde dann aber nach dem Angriff Japans auf Pearl Harbor 1941 von einem Patriotismus verdrängt, der sich bereit fand, auch in den europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs einzusteigen. Bis in die 1960er Jahre war genug Zeit verflossen, um dem Isolationismus einen neuen Aufschwung zu geben. Das Bekanntwerden von Kriegsverbrechen, die die USA im Laufe des Vietnamkriegs begingen, heizte den Protest an. Die Kriegsverbrechen Nordvietnams und des Vietkong fanden weit weniger Beachtung.
Mit dem Protest gegen den Vietnamkrieg verband sich auch das Aufbegehren der Jugendlichen, besonders der Schüler und Studenten, gegen autoritäre staatliche Strukturen. Wegen der heutigen Geschichtsvergessenheit will ich darauf hinweisen, dass die Regierungen, gegen die sich der Protest richtete, von den demokratischen Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson gestellt wurden; diese beiden Präsidenten waren es auch, die den Vietnamkrieg eskalieren ließen. Der Kriegsminister unter beiden Präsidenten, Robert McNamara, gab später zu, dass keiner, er eingeschlossen, irgendeine Ahnung hatte, was in Vietnam los war. Auch das Aufbegehren gegen autoritäre Strukturen knüpfte nicht an eine marxistische Kapitalismuskritik an, jedenfalls nicht zunächst, sondern an liberal-konservative und anarchistische Vorstellungen von individueller Freiheit. Anders verhielt es sich in Westeuropa, wo die Protestwelle mit ein paar Jahren Verzögerung ankam und bereits am Anfang durch den Marxismus beherrscht wurde, wenn auch in einer von dem Sowjetmarxismus verschiedenen Form. In der amerikanischen Protestbewegung setzten sich Marxisten ebenfalls nach und nach durch. Mit zunehmender Verhärtung der Fronten sowohl in Vietnam als auch in den westlichen Staaten wandelte sich die Protestbewegung zu einer fünften Kolonne der Kommunisten.
Anfang 1973 beendeten die USA unter Präsident Richard Nixon den Einsatz amerikanischer Truppen in Vietnam. Zwei Jahre später übernahmen der Vietkong und Nordvietnam die Herrschaft im Süden. Und nun geschah, was nach kommunistischen Machtübernahmen immer geschieht: Der neue Staat verbreitete statt der versprochenen und erhofften Freiheit Terror und Elend. Viele ehemalige Südvietnamesen versuchten in ihrer Verzweiflung, mit seeuntauglichen Booten zu fliehen (der Landweg schied aus, weil zu dem Zeitpunkt alle Anrainer mit Vietnam verbündet waren). Die Schätzungen reichen bis zu zwei Millionen. Hundertausende ertranken, andere wurden gerettet. Die Bundesrepublik Deutschland lehnte übrigens die Aufnahme sogenannter „Boat People“ zunächst ab.
Wie reagierten die westlichen Unterstützer (Nord-) Vietnams? Ich hebe zwei Fälle als paradigmatisch hervor. Der deutsch-schwedische Schriftsteller Peter Weiss (1916–1982) verhöhnte die Opfer als bourgeoise Klassenfeinde, während sich Rudi Dutschke (1940–1979), Galionsfigur der bundesdeutschen Protestbewegung und Mitorganisator des legendären Vietnamkongresses in Berlin 1968, über das Vorgehen derjenigen, für deren Sieg er eingetreten sei, entsetzt zeigte.
Es kam aber noch schlimmer. In dem Nachbarland Kambodscha hatte die französische Kolonialmacht 1941 einen König eingesetzt, der versuchte, das kleine Land in den kriegerischen Auseinandersetzungen neutral zu halten. 1970 kam es zu einem von den USA initiierten Putsch. Die neue Regierung sollte die USA im Vietnamkrieg unterstützen und verhindern, dass die Grenzregion von Nordvietnam und dem Vietkong als Rückzugs- und Aufmarschgebiet genutzt wird. Der abgesetzte König verbündete sich mit der kommunistischen Guerilla, den Roten Khmer und der VR China. Zur gleichen Zeit, als der Vietkong und Nordvietnam den Süden überrollten, triumphierten die Roten Khmer in Kambodscha. Sie errichteten ein Regime von unvorstellbarer Grausamkeit. Anders als die stalinistische, auch von der VR China verfolgte Entwicklungspolitik, die die sofortige und gnadenlose Industrialisierung vorantrieb, wollten die Roten Khmer die Reduzierung auf eine rein agrarische Wirtschaft. Die Hauptstadt wurde binnen weniger Stunden komplett entvölkert, Intellektuelle tötete man; um als Intellektueller zu gelten, reichte es aus, über eine Brille zu verfügen. Am Ende der nur vierjährigen Schreckensherrschaft gab es in dem Land fast keinen Arzt mehr. Zudem waren die Roten Khmer antivietnamesische Rassisten und begannen, Vietnam militärisch zu attackieren, bis Vietnam im Jahr 1979 Kambodscha völkerrechtswidrig besetzte, die Roten Khmer entmachtete und eine Regierung von eigenen Gnaden einsetzte. Die Roten Khmer gingen erneut in den Untergrund und wurden hier sogar von den USA gegen die verhassten Vietnamesen unterstützt, die die Supermacht dermaßen gedemütigt hatten. Freilich kamen immer weitere Details über die Verbrechen der Roten Khmer ans Tageslicht, sodass sich die USA diese Unterstützung moralisch nicht mehr leisten konnten; sie ließ sich vor der eigenen Bevölkerung nicht mehr rechtfertigen.
Der Vietnamkrieg hat mich drei Dinge gelehrt, die ich für allgemeine Kennzeichen des Kriegs unter den Bedingungen halte, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit gelten:
Erstens: Regionale Befreiungsbewegungen und Guerilla-Organisationen tendieren dazu, im Laufe der kriegerischen Auseinandersetzungen zu herrschaftlichen Instanzen zu werden, die Terror gegen die eigene Bevölkerung einschließen.
Zweitens: Keine regionale Befreiungsbewegung und Guerilla-Organisation kann ohne die Unterstützung wenigstens einer Supermacht standhalten. Die Einmischung der einen zieht die Einmischung der anderen Supermächte nach sich. Die Verwicklung mit den Supermächten lässt den Konflikt zum Stellvertreterkrieg werden, in dem es dann um etwas ganz anderes geht als um eine regionale Befreiung.
Drittens: Alle Kriegsparteien tendieren dazu, Verbrechen zu begehen. Oder anders ausgedrückt: Zeig mir den Krieg, in dem zumindest eine Seite alle völker- und kriegsrechtlichen Beschränkungen eingehalten hat, wenn sie unter militärischen Druck geraten ist. Eine moralisch richtige Seite kommt nur zustande, wenn man die Augen vor deren Verbrechen verschließt.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.