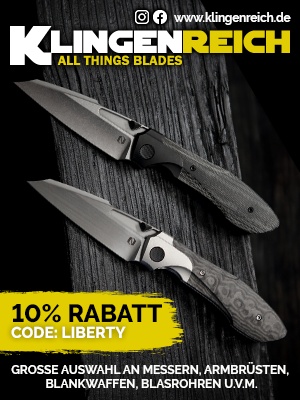Verfassungskunde: Mein Grundgesetz
Liebeserklärung an eine Fünfundsiebzigjährige

Wir haben uns in Deutschland angewöhnt, den 23. Mai eines Jahres als Tag des Grundgesetzes zu feiern. Das kann man tun, man muss es aber nicht. Denn in Kraft getreten ist diese Verfassung erst am 24. Mai 1949. Und weil man sich sonst an Geburtstage üblicherweise an dem Tag erinnert, an dem jemand das Licht der Welt erstmals erblickt hat, erscheint es mir legitim, den 75. Geburtstag auch erst am 24. Mai 2024 zu begehen.
Was ist nicht alles gesagt und geschrieben worden über die deutsche Verfassung! Beharrlich hält sich das Ondit, sie sei gar keine Verfassung, sondern „nur“ ein Grundgesetz. Anarchisten wenden gegen seine Legitimation ein, es gebe anderen Menschen überhaupt nichts zu befehlen. Andere wiederum wähnen Vorgängerverfassungen noch für gültig. Ich selbst halte alle diese Argumente nicht für stichhaltig. Die Bevölkerung des Landes hat dem Ganzen zugestimmt – wenn nicht ausdrücklich per Wahlkreuz, dann doch stillschweigend durch praktische Übung. Da ständig Menschen geboren werden, ist der jeweilige Bestand an Teilnehmern schwankend – mithin müssen diejenigen, die dem Regelwerk mangels Geschäfts- und Einsichtsfähigkeit noch nicht zugestimmt haben, die Spielregeln der Vorgänger hinnehmen. Und dass ein deutscher Kaiser je eine Volksabstimmung über eine vorangegangene Konstitution abgehalten hätte, die deswegen eine höhere Legitimität für sich reklamieren könnte, möchte ich ausschließen.
Blicken wir also fröhlich und glücklich auf das Grundgesetz, während dessen Geltungsdauer sich über mehr als 70 Jahre eine – bei allem Streit um Details – im Wesentlichen sehr lebenswerte Rechtsordnung ausformuliert hat. Nichts auf Erden ist perfekt und endgültig. Deswegen sahen wir auch in den vergangenen vier Jahren massive Angriffe auf unser verfassungsrechtlich geordnetes Zusammenleben. Die pandemischen Kulturbrüche und Rechtsverletzungen müssen aufgearbeitet werden. Das steht außer Frage. Aber die Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes, seine Ewigkeitsklausel, der unhintergehbare Anspruch, die überpositiven Menschenrechte zu wahren und generell stets in den Grenzen des Übermaßverbotes zu handeln – all dies sind Instrumente, um Legislative, Exekutive und auch Judikative wieder auf den Weg des Rechtes zurückzuführen, wo sie ihn verlassen haben. Man muss es nur wollen. Und man muss es nur beharrlich einfordern. Das Recht, sagten die Römer, ist für die Wachsamen. Wer schläft, verliert seine Rechte.
Und weil alles Recht stets in Bewegung ist, um mit den Anschauungen der Menschen und den neuesten Umstandsbedingungen einen guten Ausgleich zu formulieren, darf es auch im Diskurs weiterentwickelt werden. Einer meiner wesentlichsten Vorschläge für eine Ergänzung der Verfassung liegt in der Verrechtlichung der Politikerverantwortung. Abgeordnetenhaftung führt zu Qualitätsverbesserungen der parlamentarischen Arbeit und diszipliniert mittelbar – in der Sache ganz wichtig! – die auch derzeit noch von persönlicher Verantwortlichkeit freigestellte Politikberatung. Das ist eine offene Stelle des Grundgesetzes, die es im Geiste des Rechtes zu schließen gilt. Kein Staatshaushalt wäre überschuldet, hafteten seine Erfinder für dessen Güte. Die fehlende Verantwortlichkeit der Vertreter ist wohl ein Überbleibsel aus absolutistischen Zeiten – Könige konnten nicht irren, sagten sie. Aber nur sie.
Der dem Grundgesetztext vorangehende Formulierungsvorschlag für einen ersten Absatz des ersten Artikels lautete: „Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.“ Ich habe mich während der Exzesse aller Corona-Maßnahmen immer wieder gefragt, ob eine solche Klarstellung uns die hyperhygienisch hysterischen Verirrungen mancher Akteure erspart hätte. Ich frage mich auch, ob unter einer solchen Klausel möglich geworden wäre, die Grundrechte aller Lebenden fragwürdig gegen die künftigen Grundrechte möglicher späterer Generationen auszuspielen. Auch wenn ich mir mit meinen Antworten bei diesen beiden Fragen nicht sicher bin, so glaube ich doch fest daran, dass eine persönliche Verantwortlichkeit manchen Lockdowner oder Zwangstherapiefreund noch einmal nachdenklich gestimmt hätte.
Vielleicht ist es am Ende just das Republikprinzip, das nicht nur eine persönliche Haftung für das Bestimmenwollen über andere erfordert, sondern auch einen guten Schutz gegen unpersönliche supranationale Entfremdungen zwischen Bürgern und Staatsrepräsentanten bietet. Eine Regierung „aus dem Volk, für das Volk, durch das Volk“, wie es die amerikanischen Verfassungsväter vordachten, verliert ihren Ankerpunkt inmitten der Bevölkerung, wenn Normen von ungewählten Akteuren und ohne deren Verantwortlichkeit innerhalb der Rechtsordnung gesetzt werden können.
Schreiben wir die Verfassungsgeschichte also im Geiste des Grundgesetzes fort – und nicht gegen seine tragenden Prämissen! Bislang waren wir mit diesem Rahmen meistens gut gefahren. Verbessern wir ihn, statt ihn infrage zu stellen. Vielleicht feiern wir zum Hundertsten dieser Verfassung dann eine kluge und angemessene Verrechtlichung des Politischen. Schön wär’s!
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.