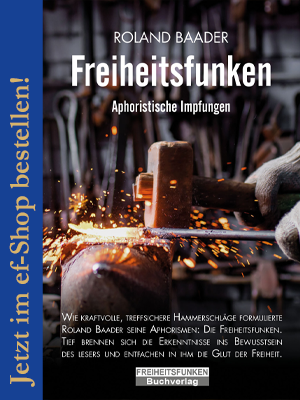Innerdeutsche Wahlanalyse: Kommunalwahlen in acht Bundesländern
Bröckelt die Brandmauer?
von Thomas Jahn drucken

Während die Wahlergebnisse des letzten Sonntags für die Europawahl schon ausführlich analysiert wurden, liefen die zeitgleich abgehaltenen Kommunalwahlen in vier mitteldeutschen, drei westdeutschen Bundesländern und der Hansestadt Hamburg deutlich unter dem politischen Radar, obwohl der Ausgang teilweise durchaus bemerkenswert war. Schauen wir zunächst nach Westen:
In Rheinland-Pfalz, dem einstigen Stammland der CDU und Heimat von Helmut Kohl, erzielte die CDU 31,5 Prozent und landete mit großem Abstand vor der SPD mit 20,2 Prozent. Die CDU verbesserte sich aber im Vergleich zur Wahl von 2019 nur sehr leicht um 0,4 Prozentpunkte. Auf Platz drei folgte die AfD mit 14,0 Prozent und einem Plus von 5,7 Punkten, gefolgt von den Grünen mit 11,0 Prozent und einem Minus von 5,1 Punkten. Die FDP erreichte 4,5 Prozent und damit 1,6 Punkte weniger. Im Vergleich zu 2019 konnten die Freien Wähler ihr Ergebnis um 3,5 Punkte auf nun 3,9 Prozent verbessern. Die Linke halbierte ihr Ergebnis in etwa um 1,8 Punkte auf 1,7 Prozent. Das erstmals angetretene „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) holte 1,2 Prozent. Viel Veränderung in den Kreis- und Gemeinderäten wird es daher sicher nicht geben. Die AfD konnte auch keine Landrats- oder Oberbürgermeisterwahl für sich entscheiden.
Ein ähnliches Bild zeigt sich in Baden-Württemberg. Trotz deutlicher Zugewinne bei CDU und AfD dürften die drei größten Städte, Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe, in linker Hand bleiben. Landesweite Ergebnisse für die Wahlen der Kreis- und Gemeinderäte dürften wegen des komplizierten Wahlsystems erst in einigen Tagen vorliegen.
Auch in zwei weiteren westlichen Bundesländern fanden zeitgleich mit der Europawahl Kommunalwahlen statt: In Hamburg wurden die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt und im Saarland die Bürgermeister und Gemeinderäte. Im Hamburg blieb erwartungsgemäß die SPD stärkste Kraft, im Saarland die CDU. Die AfD blieb in beiden Bundesländern knapp einstellig.
Östlich davon zeichnete sich allerdings etwas völlig anderes ab: Die AfD ist mit 26,9 Prozent stärkste kommunale Kraft in Sachsen und löste dort, wie auch in Sachsen-Anhalt mit 28,1 Prozent, die CDU ab, die in Sachsen nur noch 24,2 und in Sachsen-Anhalt 26,8 Prozent erreichte. Das neue BSW liegt in Sachsen nun etwa gleichauf mit der SPD (7,9 Prozent), den Grünen (6,7 Prozent) und der mittlerweile halbierten Linkspartei (6,9 Prozent) und erreichte aus dem Stand 8,5 Prozent. In der Landeshauptstadt Dresden zeichnet sich erstmals seit vielen Jahren eine nicht linke Mehrheit ab. Dort erreichte die von Ex-FDP-Landeschef Holger Zastrow gegründete neue liberal-konservative Kraft „Team Zastrow“ auf Anhieb 8,1 Prozent. Im Stadtrat von Dresden stellt die AfD künftig mit 19,4 Prozent die stärkste Fraktion. CDU, AfD, FDP, Freie Wähler und das „Team Zastrow“ stellen mit 37 Sitzen die Mehrheit im 70-köpfigen Stadtratsgremium von Dresden. In Leipzig hingegen dominieren die linken Kräfte trotz erheblicher Verluste weiterhin den Stadtrat. Grüne, SPD, Linkspartei und BSW kommen dort auf insgesamt 38 von 70 Sitzen. Mit 13 Sitzen bleibt die CDU knapp stärkste Fraktion.
Auch in Brandenburg konnte die AfD am vergangenen Sonntag feiern. Sie ist mit 25,7 Prozent erstmals klare Siegerin der dortigen Kommunalwahlen. Auf Platz zwei folgt leicht gestärkt die CDU mit 19,3 Prozent und mit leichten Verlusten die SPD mit 16,6 Prozent auf Platz drei. Klare Verlierer sind die Linkspartei, die 6,3 Prozentpunkte einbüßt und auf 7,8 Prozent kommt. Auch die Grünen verlieren deutlich (minus 4,4 Prozentpunkte) und erreichen 6,7 Prozent. Die Freien Wähler landeten bei 7,4 Prozent. Bemerkenswert für Brandenburg war, dass das BSW dort nicht eigenständig und flächendeckend antrat, sondern nur lokal und gemeinsam mit anderen Bündnissen, also nicht unter dem eigenen Namen. Dies mag das verhältnismäßig gute Abschneiden der SPD erklären.
In Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich ein ähnliches Bild. Die AfD landete auch dort mit 25,6 Prozent auf Platz eins, gefolgt von der CDU mit 24,0 Prozent. Die SPD stürzte auf 12,7 Prozent ab. Kaum eine Rolle spielten die Grünen mit 5,5, die Freien Wähler mit 1,8 und die FDP mit 2,8 Prozent.
Thüringen wählte seine Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte schon am 26. Mai. Auch hier erzielte die AfD, obwohl sie keine Landrats- oder Bürgermeisterposten ergattern konnte, erhebliche Zugewinne und landete landesweit mit 25,8 Prozent knapp hinter der CDU, die mit 27,2 Prozent annähernd dasselbe Ergebnis wie beim letzten Mal erzielte. Erhebliche Verluste fuhren dort die „Ampel-Parteien“ und die auf Landesebene regierende Linkspartei ein, die von 14,0 auf 9,1 Prozent abstürzte.
Wie schon bei der Europawahl stieg die AfD somit auch auf kommunaler Ebene zur stärksten politischen Kraft in allen neuen Bundesländern auf. Dabei ist klar, dass die kommunale Verankerung einer Partei eine wichtige Voraussetzung für künftige Wahlerfolge auf Landes- oder Bundesebene ist. Je größer die AfD-Fraktionen sind, die künftig den Stadt- und Gemeinderäten sowie den Kreistagen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern angehören, desto geringer sind die Chancen, die bisherige Ausgrenzungsstrategie aufrechtzuerhalten. Auf kommunaler Ebene gelten andere Gesetze als in den Parlamenten auf Landes- oder Bundesebene. Die meisten Kommunalpolitiker kennen sich auch über Parteigrenzen hinweg. Gerade in kleineren Gemeinden bestehen familiäre, geschäftliche oder sogar freundschaftliche Verbindungen quer durch alle Parteien. Auch wenn die AfD bislang nur sehr wenige Bürgermeister und nur einen Landrat stellt, kann sie ab einem Stimmenanteil von 30 Prozent und mehr aber natürlich erheblichen Einfluss auf kommunale Entscheidungen nehmen, vor allem, wenn parteiunabhängige Wählergruppen aus der Abwehrfront „gegen Rechts“ ausscheren. In den größeren Städten müssen zudem häufig Dezernenten- oder Referatsleiterposten mit berufsmäßigen Kommunalpolitikern besetzt werden. Diese Ämter werden, anders als die Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister, nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von den ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern in geheimer Wahl. Die AfD hätte in den betreffenden Städten die Chance, hauptamtliche Dezernentenposten zu besetzen, wenn es zu Absprachen mit anderen Parteien nach dem überall in der Politik geltenden Gesetz des Kuhhandels („Do ut des“-Prinzip) kommt. All dies wird zu einer Normalisierung der politischen Verhältnisse beitragen und auf die jeweilige Landesebene ausstrahlen.
Die Alltagsarbeit in den kommunalen Gremien und die Notwendigkeit zur Kooperation und Einbindung der deutlich gewachsenen AfD-Fraktionen können also zu einer Änderung im bisherigen Umgang der etablierten Parteien mit der AfD führen. Zumindest in den neuen Bundesländern dürfte die Zeit der Brandmauer der Vergangenheit angehören. Die neue Partei BSW muss nun zeigen, ob sie tatsächlich neue Wege beschreiten oder nur als trojanisches Pferd der Linkspartei oder von Rot-Grün agieren möchte.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.