Szientismus: Der falsche Glaube an die Wissenschaft
Und ihr positivistisches Korsett
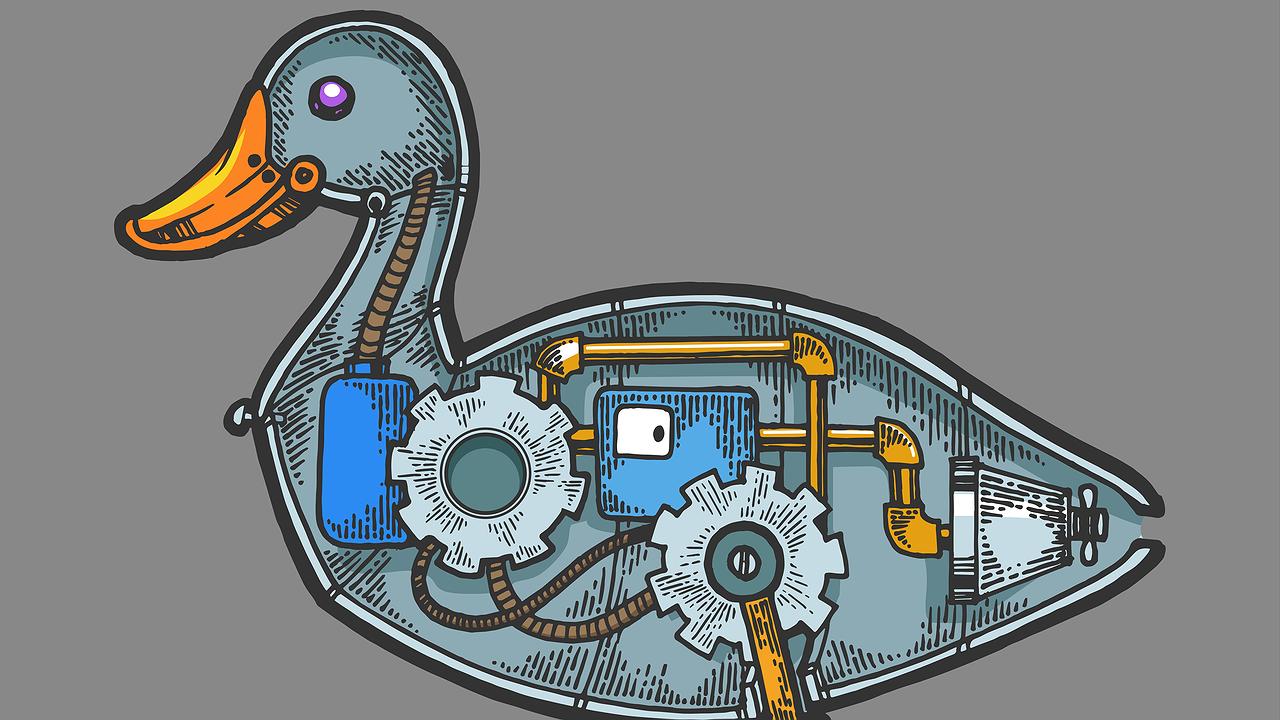
Unter „Szientismus“ versteht man die Auffassung, dass man mit wissenschaftlichen Methoden alle sinnvollen Fragen beantworten kann. Als „wissenschaftlich“ gelten dabei Aussagen, die sich durch die positivistische Methode begründen lassen. Dadurch wird die Abgrenzung dessen, was als Wissenschaft gelten darf, auf einen engen Raum eingegrenzt.
Positivismus
Positivismus als Methode bezieht sich auf die Verwendung empirischer Beweise, die durch Beobachtung und Experimente gewonnen wurden. Wissen wird aus den Sinneserfahrungen abgeleitet, wobei die Objektivität durch das Kollektiv der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu sichern ist. Damit wissenschaftliche Erkenntnisse als solche anerkannt werden, sollen sie einen Prozess der wechselseitigen Prüfung durchlaufen (Peer-Review). Karl Poppers „Kritischer Positivismus” hat darüber hinaus das Kriterium ins Spiel gebracht, dass nur insofern eine wissenschaftliche Theorie vorliegt, wenn sie widerlegbar ist (Falsifikationskriterium).
Als Folge des Wissenschaftsglaubens hat sich der moderne Wissenschaftsbetrieb ein eigenes Korsett aufgebaut, in dem er nun gefangen ist. Die Kritik richtet sich darauf, dass beim reduktionistischen Ansatz die Phänomene übermäßig vereinfacht werden und die ganzheitliche Perspektive (Kontextualisierung) bewusst ausgeklammert wird. Zudem wird die wechselseitige Überprüfung der Forschungsergebnisse immer unzuverlässiger, je weiter die Spezialisierung voranschreitet. Die Gruppe der Experten für das jeweilige Fachgebiet schrumpft, und es entstehen Cliquen und Seilschaften. Die Objektivität geht verloren. Mit dem vielen Geld, das seitens der öffentlichen Hand in die Forschung fließt, kommt die Korruption. Die Wahrheitsliebe bleibt auf der Strecke. Von der Öffentlichkeit kaum beachtet, fliegt ein Schwindel nach dem anderen auf. Das 2010 auf privater Initiative von Akademikern initiierte Wissenschaftsobservatorium „Retraction Watch“ berichtet, dass allein 2023 rund zehntausend wissenschaftliche Forschungspapiere wegen grober Fehler zurückgezogen werden mussten, darunter auch Arbeiten von hochrangigen und häufig zitierten Wissenschaftlern.
Nach Rupert Sheldrake („The Science Delusion“, 2012) behindert der Szientismus den wissenschaftlichen Fortschritt, weil er seine grundlegenden Annahmen nicht mehr hinterfragt, sondern sie als Dogma betrachtet. Zu Recht wird kritisiert, dass Szientismus statt Wissenschaft die Wissenschaftsgläubigkeit predigt. Zu diesen problematischen Grundannahmen des modernen Wissenschaftsbetriebes zählen unter anderem, dass
- die Natur durchgängig mechanistisch sei und auch lebende Organismen wie eine Maschine funktionieren;
- die Materie, einschließlich der lebenden Organismen, zu denen auch der Mensch zählt, kein Bewusstsein habe;
- es fixe Naturgesetze gebe, die durch Konstanten ein für alle Mal festgelegt, also unveränderlich seien;
- die Natur nur Ursachen, aber keine Zwecke kenne. Weder der tierliche noch der menschliche Evolutionsprozess habe ein Ziel;
- psychische Phänomene illusorisch seien und ihre Untersuchung von vornherein als unwissenschaftlich zu gelten habe;
- die mechanistische Medizin die einzige anerkannte Heilmethode sei.
Das wirksamste Mittel dazu, dass diese Kriterien eingehalten werden, liefert die Forschungspolitik. Kein Forschungsprojekt, das sich nicht strikt an diese Vorgaben als Glaubenssätze hält, kann mit größeren Geldmitteln seitens des Staates rechnen. Selbst die oft schon untersuchte Tatsache, dass der Wissenschaftsbetrieb zwar immer größere Geldsummen absorbiert, die Ergebnisse aber immer bedeutungsloser werden, hat noch zu keiner Abkehr von diesem Muster geführt. Immer mehr „Papers“ werden publiziert, aber nur wenige davon gelesen, und ein minimaler Anteil daran hat überhaupt einen Effekt. Die wenigen Forscher, die unkonventionelle Wege beschreiten, zahlen ihre Wahrheitssuche mit getrübten Karriereaussichten und es liegt auf der Hand, dass vor allem jüngere Akademiker von vornherein Forschungsansätze vermeiden, die dem herrschenden Wissenschaftsdogma widersprechen.
Szientismus impliziert Technokratie
Der Szientismus führt direkt zum „technologischen Imperativ“, wonach eine Beschränkung der wissenschaftlichen Forschungsbereiche moralisch nicht gerechtfertigt ist. Was erforscht werden kann, soll erforscht werden. Von diesen beiden Grundsätzen ausgehend gelangt man zur Szientokratie, wonach die Gesellschaft wissenschaftlichen Kriterien entsprechend zu organisieren sei.
Selbst ethische Grundsätze seien nach wissenschaftlicher Methodik zu ermitteln und auf die menschlichen Beziehungen anzuwenden. Dabei gilt allerdings das Primat der Methode. Was der positivistischen Methodik nicht zugänglich ist, wird von vornherein ausgeschlossen.
Friedrich von Hayek (1899–1992) hat vor vielen Dekaden schon das Grundproblem umrissen. Dem szientistischen Konstruktivismus gemäß soll die planerische Vernunft in der Lage sein, die Handlungen der zahlreichen Mitglieder einer komplexen sozialen Ordnung zu koordinieren. Nach der konstruktivistischen Sichtweise soll der Mensch in der Lage sein, soziale Institutionen wie Gesetze und Moral bewusst zu konstruieren oder zu erfinden, weil er „Vernunft“ besitze. Solche rationalistischen Gesellschaftsentwürfe (wie sie zum Beispiel im Sozialismus deutlich zutage treten) missverstehen jedoch die Prozesse, die für das Wachstum der Zivilisation gelten. Sie schreiben der planenden Vernunft eine ungerechtfertigte Autorität zu. Die Konstruktivisten glauben, dass die menschliche Vernunft imstande sei, sowohl im Hinblick auf den kulturellen Fortschritt als auch auf die Schaffung der guten Gesellschaft gültige Modelle zu entwickeln, die dann praktisch umzusetzen seien. Dieser Anspruch, der seit der Aufklärung vorherrscht, entspringt einer falschen Erkenntnistheorie.
In dem konstruktivistischen Denken ist eine Tendenz zu animistischem oder anthropomorphem Denken angelegt, zu irreführenden Abstraktionen wie „die Gesellschaft“ oder „die Nation“. Der majestätische Plural des „Wir“, den auch heute noch die politischen Führer gern benutzen, gibt davon Zeugnis. Der Konstruktivist neigt dazu, seine Abstraktionen zu personifizieren und diesen mentalen Konstrukten – sei es der „Staat“ oder das „Volk“ – operative Vernunft ebenso zuzusprechen wie Schuld, Verantwortung und bestimmte Ziele und Zwecke. Es ist dieses animistische Denken, das charakteristisch für alle Schulen des totalitären, sozialistischen und interventionistischen politischen Denkens ist.
Szientismus ist ein fehlerhafter Ansatz zur Erklärung sozialer Phänomene, weil er annimmt, dass menschliches Verhalten auf eine Reihe universeller Gesetze reduziert werden könne. Menschen sind aber bewusste Akteure, deren Handlungen auf einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich eigener Überzeugungen und Werte, basieren. Der konstruktivistische Rationalismus erfasst nicht die Komplexität und Vielfalt menschlicher Erfahrungen. In krasser Weise zeigt sich das immer wieder, wenn die staatlichen Organe versuchen, vermeintliches „Marktversagen“ zu korrigieren.
Konstruktivisten unterliegen dem Irrtum, es gebe eine voll entwickelte menschliche Vernunft, die der sozialen Erfahrung voranginge, und diese Ratio es sei es, die den Fortschritt steuere. Hayek nennt dies „synoptische Täuschung“, die Fiktion, dass alle relevanten Tatsachen dem menschlichen Verstand bekannt sein könnten und dass es möglich sei, aus dieser Kenntnis die wünschenswerte soziale Ordnung zu konstruieren.
In der Praxis ist der Szientismus notwendigerweise an das Expertentum und damit an die Spezialisierung geknüpft. Szientismus ist die Basis der Technokratie. Für diese ist kennzeichnend, dass ihre Entscheidungen systematisch nicht nur den sozialen, kulturellen und ethischen Kontext eines Problems vernachlässigen, sondern auch die Erkenntnisse anderer Disziplinen, selbst wenn sich diese an die positivistische Methodik halten. Das bedeutet, dass technokratische Entscheidungen, ob sie nun richtig oder falsch sein mögen, grundsätzlich immer auf unvollständigen Analysen beruhen. Das folgt aus dieser Wissenschaftstheorie schon von selbst, weil nach der positivistischen Methodik wissenschaftliche Thesen über empirische Sachverhalte nicht als abgeschlossen gelten können, sondern immer nur vorläufig sind.
Aber nicht nur daran leidet der Szientismus. Wissenschaft ist eine soziale Praxis, die in einem spezifischen historischen Kontext betrieben wird. Praktisch ist Wissenschaft weder unabhängig noch neutral, sondern durch soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren geprägt. Die Fragen, die Wissenschaftler zur Untersuchung wählen, und die Methoden, die sie anwenden, vor allem die Interpretationen der Ergebnisse, können nicht positivistisch bestimmt werden. Wissenschaftler sind nicht frei von Vorurteilen oder Ideologien.
Der Szientismus führt zu einer reduktionistischen Sichtweise der Welt. Komplexe Phänomene werden auf ihre einfachsten Bestandteile reduziert, deren Zusammenwirken meist mechanistisch interpretiert wird. Folge des szientistischen Reduktionismus ist Übervereinfachung, Überspezialisierung und Fragmentierung. In dem Maß, wie dabei der Kontext verlorengeht, verliert sich der Szientismus in einer technokratisch-instrumentellen und verengenden Sichtweise der Probleme. Die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen nimmt in dem Maße zu, wie sich die technokratische Machtfülle ausbreitet. Auf diese Weise führt die Ausbreitung der Szientokratie auf direktem Wege zum technokratischen Totalitarismus (ausführlich hierzu Antony P. Mueller, „Technokratischer Totalitarismus“, Neuedition 2024).
Resümee
Der epistemologische Grundirrtum der Konstruktivisten geht weit über die Erkenntnistheorie hinaus und führt zu verheerenden politischen Irrtümern. Die konstruktivistischen Überzeugungen machen ihre Vertreter blind, um die wahre Natur der sozialen Realität zu erkennen. Soziale Institutionen sind als Träger impliziten Wissens zu verstehen, einem Wissen, das weit über das hinausgeht, was dem bewusst denkenden Verstand zur Verfügung steht. Das in der spontanen Ordnung vorhandene Wissen übersteigt das rationalistische Wissen, weil sich in ihr viel mehr Versuche und Irrtümer niedergeschlagen haben, als sie ein einzelner Mensch oder ein Forscherteam je gewinnen könnte.
Antony P. Mueller (2024): Technokratischer Totalitarismus (Neuedition)
Rupert Sheldrake (2012). The Science Delusion
Friedrich August vonHayek (1969):Freiburger Studien
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.

