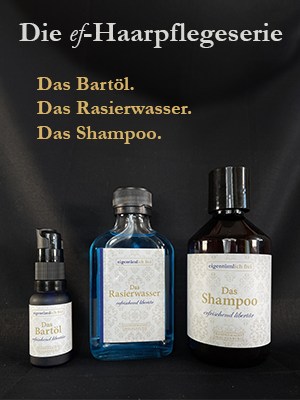Libertäre Philosophie – Teil 35: Ayn Rand: Der Streik der Egoisten
Altruismus als Verhängnis

In Philosophiegeschichten, philosophischen Seminaren an akademischen Institutionen und in populär- oder fachwissenschaftlichen Abhandlungen wird man Ayn Rand (1905–1982) normalerweise nicht begegnen. Dennoch zählt sie zu den einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ihr monumentaler Roman „Atlas Shrugged“ (1957), in dem sie ihre Philosophie darlegt, verkauft sich seit seiner Publikation als Dauerbestseller, obwohl es fast ausschließlich negative Rezensionen gab (und gibt). In Deutschland war von dem Erfolg wenig zu spüren, für das deutsche Publikum ist Ayn Rand einfach zu amerikanisch. Es gibt vier Übersetzungen unter vier verschiedenen Titeln: „Atlas wirft die Welt ab“ (1959), „Wer ist John Galt?“ (1997), „Der Streik“ (2012) und „Der freie Mensch“ (2021).
Zu amerikanisch? Als Alissa Sinowjewna Rosenbaum in Sankt Petersburg geboren, emigrierte sie, die schon als Kind beschlossen hatte, Schriftstellerin zu werden, 1926 in die USA. Kritiker bezeichnen ihre Positionen pro Egoismus, pro Individualismus, pro Kapitalismus als „überangepasst“, was insofern in die Irre führt, als ihre Positionen selbst in den USA zunehmend marginalisiert werden, auch wenn sie noch über einen großen Rückhalt in der Bevölkerung verfügen. In den USA lernte sie den angehenden Schauspieler Frank O’Connor kennen, der seine Karriere aufgab und sich als Farmer niederließ, um ihr das Schreiben zu finanzieren.
In „Atlas Shrugged“ – der deutsche Titel „Der Streik“ greift auf ihre ursprüngliche Idee zurück und trifft den Inhalt besser als der Titel, unter dem sie den Roman veröffentlichte – zeichnet Ayn Rand die nur leicht fiktionalisierten USA, die unter der Kumpanei der Unternehmer mit dem bürokratischen und alle Kreativität tötenden Staat zugrunde zu gehen drohen. Eine Gruppe von Verweigerern tritt in den Streik und organisiert eine von dem legendären John Galt geführte Untergrund-Ökonomie, die letztlich triumphiert. In zweihundert Seiten am Schluss legt John Galt als Sprachrohr Ayn Rands seine Philosophie der zukünftigen befreiten Gesellschaft dar. Natürlich ist Ayn Rands Idee eines siegreichen (General-) Streiks der kreativen Unternehmer genauso eine Utopie wie die Idee eines siegreichen (General-) Streiks der kreativen Arbeiter, die die Syndikalisten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts formulierten. Die gesamte Arbeiterbewegung, egal, welcher Fraktion, war sich sicher, dass für den Fall, dass die Herrschenden in Europa einen weiteren Krieg anzetteln sollten, ein internationaler Streik der Arbeiter ihn verhindern würde. Die Arbeiter Europas folgten den nationalistischen Parolen. Analog dazu setzen die Unternehmer ihre Kumpanei mit dem Staat fort, so kontraproduktiv dieser auch agieren mag. Die Menschen handeln unter allen gegebenen Bedingungen in der Weise, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen, ohne sich nass zu machen. Widerstand leisten immer nur wenige. Irgendwie war das auch Ayn Rand klar, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Ayn Rands Philosophie steht aber nicht nur gegen den Mainstream der geschichtlichen Entwicklung hin zu mehr Staatsgewalt, sondern vielmehr auch gegen einen zentralen Glaubenssatz der amerikanischen Tradition: Für sie stellte nicht Altruismus die Haupttugend dar, sondern Egoismus. Eine solche Aussage stößt zunächst, abstrakt dahin gesagt, immer auf schroffe Ablehnung. Dabei ist Ayn Rands Begründung so plausibel wie nur möglich: Das politische Unheil in aller Geschichte von Anbeginn ist die Behauptung der Gewalttäter, im allgemeinen Interesse zu handeln. Erst diese Behauptung erteilt die Lizenz zu Verfolgung, Folter, ethnischen Säuberungen und Genozid. Niemand tut dies im eingestandenen Eigeninteresse. Hier landen wir dann bei Max Stirner (Teil 25) und Friedrich Nietzsche (Teil 27), beides allerdings Philosophen, die Ayn Rand ablehnte.
Anders als Stirner und Nietzsche ging Ayn Rand davon aus, dass die Welt erstens objektiv erkennbar sein (darum nannte sie ihre Philosophie „Objektivismus“) sowie dass zweitens in Erkenntnistheorie, Moralphilosophie und ästhetischer Theorie alle Wahrheiten aus den logischen Urprinzipien unzweifelhaft abzuleiten seien. Die beiden Urprinzipien sind die Parteinahme für das Leben (ein überaus sympathisches und menschenfreundliches Prinzip, das Ayn Rands Kritiker sich hinter die Ohren schreiben sollten) und die aristotelische Logik, vor allem die Selbstidentität („A ist A“), woraus sich die Zurückweisung jeglicher Dialektik ergibt (siehe Hegel, Teil 23 dieser Serie). Der Anspruch der logischen Ableitbarkeit aus den Urprinzipien ging bis hin zu der grotesken Situation, dass Ayn Rand jeden aus ihrem Zirkel von Anhängern ausschloss, der den „falschen“, weil (angeblich) freiheitsfeindlichen und vernunftwidrigen Musikgeschmack hegte und etwa Beethoven hörte. Hier sehen wir dann doch die Dialektik am Werk: Der Standpunkt des absoluten Individualismus schlägt in die kollektive Verordnung selbst des „richtigen“ Geschmacks um. Von der Frau eines Mitglieds des Zirkels forderte ein Mitarbeiter Ayn Rands, dass sie entweder ihren presbyterianischen Glauben aufgeben (Ayn Rand war erklärte Atheistin, auch das trennte sie von der amerikanischen Tradition) oder dass sich ihr Mann von ihr trennen müsse – es kam anders, denn er verließ den Zirkel. Damit verhielt er sich natürlich egoistisch, aber nach Meinung von Ayn Rand nicht „rational“.
Aber auch abgesehen von diesen kollektivistischen Exzessen im Zirkel Ayn Rands ergibt sich aus ihrer Verteidigung des Egoismus ein dialektischer Widerspruch. Wenn der Altruismus abgelehnt wird, weil er in Wirklichkeit ein Egoismus und für alle schlecht ist, ist der selbstbewusste Egoismus für alle gut (oder wenigstens besser als der Altruismus). Insofern ist der Egoismus, weil er Tugend ist, eben doch altruistisch. Man könnte demgegenüber wie Stirner einfach konstatieren, dass der Altruist in Wirklichkeit ein Egoist und damit völlig im Recht sei. Nur du, der du dich dem Scheinaltruisten anschließt und seinem Egoismus dienst, also dein Eigeninteresse hintanstellst, bist schlicht ein Idiot. Egoismus ist (nach Stirner) keine Tugend: Er fordert nicht dazu auf, egoistisch zu sein, sondern trifft nur die Aussage, es gebe keinen Grund, altruistisch zu handeln. Bei Ayn Rand hingegen findet sich eine Moral, und Moral ist immer auf die Beziehung zum anderen Menschen gerichtet, der Altruismus ist ihr angeboren: Das Argument, der Egoismus sei für alle besser als der Altruismus, ist altruistisch.
Diese Dialektik verstand Ayn Rand nicht. Die Verteidigung des Kapitalismus, er sei die für alle beste Form der wirtschaftlichen Organisation (Ludwig von Mises, Teil 36 dieser Serie), warf sie vor, kollektivistisch und altruistisch zu sein. Nein, es solle tatsächlich nur jeder seinen eigenen Vorteil suchen, das wäre tugendhaftes Handeln. Aber warum dann gegen das System streiken, etwas, das einem nur Nachteile und Scherereien einhandelt, und nicht unter den gegenwärtigen Bedingungen danach trachten, für sich das meiste herauszuschlagen?
Philosophiegeschichtlich frönte Ayn Rand einem erstaunlichen Reduktionismus: Vor ihr, als der Höhepunkt des menschlichen Denkens überhaupt, ließ sie nur Aristoteles (Teil 8) und Thomas von Aquin (Teil 14) gelten, alles andere sei Schrott. Die Berufung auf Thomas von Aquin ist bei ihrem schroffen Atheismus erstaunlich. Ihre Entgegensetzung von Thomas von Aquin zu Augustinus (Teil 10) als seinem „Gegenpol“ hat aber etwas für sich und prägte meine eigene Rezeption stark. Dass sie Augustinus mit seinem Primat des Glaubens über die Vernunft ablehnte, ist nachvollziehbar. Weniger nachvollziehbar ist jedoch ihre völlige Ablehnung von Kant (Teil 22). Denn ihre Moralphilosophie als Ableitung aus Urprinzipien ist offensichtlich kantianisch und überhaupt nicht aristotelisch: Aristoteles entwickelte seine Ethik hermeneutisch aus dem, was die Menschen unter Recht und Unrecht verstehen, und leitete sie nicht aus Urprinzipien ab. Zumindest die Einbeziehung von Kant, Hegel, Stirner und Nietzsche würde der Philosophie von Ayn Rand gute Dienste erweisen. Ebenso wäre eine Distanzierung von diesem unsäglichen Anspruch des „Objektivismus“ notwendig, um für irgendeinen rationalen Diskurs anschlussfähig zu sein.
Um es einmal ganz widervernünftig emotional zu sagen: Für mich hat Ayn Rand einige sehr sympathische Seiten, denen andere Seiten entgegenstehen, die unter dem Mantel der totalen Vernunfthörigkeit einen Sektencharakter transportieren. Dass sie aus der Geschichte der Philosophie gemeinhin ausgeschlossen wird, ist allerdings nicht gerechtfertigt. Aber selbst Feministen nehmen sie nicht in Schutz, denn ihr Liberalismus macht sie für den doch eher (staats-) sozialistischen oder gar kommunistischen Feminismus unannehmbar.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.