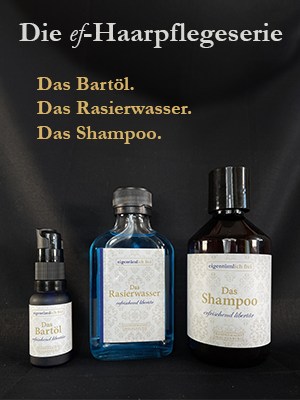Krieg und Frieden – Teil 14: Mit Sezession Politik machen statt Recht schaffen
Was mich die Jugoslawienkriege lehrten

Obwohl die (Sozialistische) Föderative Republik Jugoslawien sich in kritischer Distanz zur UdSSR gehalten hatte, folgte dem Niedergang der UdSSR ab Anfang der 1990er Jahre auch der Zerfall Jugoslawiens in Einzelstaaten. Der Zerfall wurde mit mehr oder weniger großem militärischen Einsatz von der Zentrale zu unterbinden versucht, letztlich erfolglos. Der Krieg um Kroatien dauerte vier Jahre (1991 bis 1995) und kostete neben mehreren Zehntausend toten Soldaten auch Hunderttausende von Vertriebenen im Zuge gegenseitiger ethnischer Säuberungen. Der Bosnienkrieg fand von 1992 bis 1995 statt und forderte trotz seiner kürzeren Dauer vermutlich deutlich mehr Todesopfer. Der Kosovokrieg ereignete sich von 1998 bis 1999 und beinhaltete einen völkerrechtlich umstrittenen Nato-Einsatz, an dem sich auch die Bundesrepublik Deutschland unter Führung einer rot-grünen Regierung (Außenminister: Joschka Fischer, Grüne) in einem erstmaligen Auslandseinsatz ihrer Truppen beteiligte.
Die Jugoslawienkriege zeigen erneut, welche Schwierigkeiten sowohl in der von Immanuel Kant formulierten Bedingung des Friedens, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staats, als auch im Selbstbestimmungsrecht der Völker verborgen sind, wenn es um den konkreten Fall geht.
Ich beginne mit der Nichteinmischung. Sie ließ offen, dass ein Staat einen anderen Staat um Waffenhilfe bitten dürfe, wenn er von außen oder innen einem Angriff ausgesetzt sei. Aber ab wann ist ein Staat legitim und darf um Waffenhilfe bitten? Im Koreakrieg (1950–1953) und im Vietnamkrieg (1965–1975) baten die angegriffenen Staaten Südkorea beziehungsweise Südvietnam die USA um Waffenhilfe. In der DDR (1953), Ungarn (1956) und Afghanistan (1979–1989) baten Regierungen die UdSSR um Waffenhilfe gegen innere Aufstände, und sogar bei dem Einmarsch in die CSSR 1968 hatten sich Teile der Regierung gefunden, die die UdSSR um Waffenhilfe gegen die Reformer baten.
Die Frage, welche Regierung in einem Land legitimiert sei, einen anderen Staat um Waffenhilfe zu bitten, ist aber nur die formaljuristische Seite, die die moralische Seite nicht abdeckt. Denn sollte es tatsächlich so sein, dass das Völkerrecht oder die Bedingung des Friedens jeder noch so brutalen, formaljuristisch aber legitimen Regierung das Recht zuspricht, sich Waffenhilfe von außen zu holen, es jedoch verbietet, der geschundenen Bevölkerung Waffenhilfe zu gewähren? Ich nenne ein besonders hartes Beispiel: 1979 besetzte das kommunistisch wiedervereinigte Vietnam das ebenfalls kommunistische Nachbarland Kambodscha und beendete damit die Schreckensherrschaft der Roten Khmer. Die Beendigung dieser Schreckensherrschaft war wohlgemerkt weder das Ziel noch der Auslöser der vietnamesischen Okkupation, sondern das waren die fortwährenden Grenzscharmützel, in die die Regierung Kambodschas den feindlichen Bruderstaat verwickelt hatte. Die Okkupation Kambodschas durch Vietnam war sicherlich völkerrechtswidrig und die USA unterstützen die Koalition der Gegner Vietnams, zu der auch die Roten Khmer gehörten. Ist das der völkerrechtlich korrekte Standpunkt? Es ist ein möglicher Standpunkt; er ist nicht nur möglich, sondern auch weitgehend die völkerrechtliche Realität. Aber es ist kein moralischer Standpunkt. Im Gegenteil, es ist ein höchst unmoralischer Standpunkt, der die Staatsterroristen begünstigt und den Widerstand erschwert. Der Standpunkt mag Völkerrecht heißen, er setzt aber Unrecht gegen Recht durch und kann sicherlich keinen Frieden garantieren, jedenfalls nicht, solange sich ein Freiheitswille irgendwo doch noch Bahn bricht.
Die Kritiker des Kosovo-Einsatzes der Nato operierten und operieren bis heute mit einer Verniedlichung des Vorgehens der serbischen Truppen beim Kampf gegen die Sezession des Kosovo. Die Aufklärung darüber, was von den Berichten über Kriegsgräuel einer Seite der Wirklichkeit entspricht und was Propaganda ist, ist sicherlich ein wichtiger Beitrag für den Frieden. Doch hängt der isolierten Behauptung, die einer Seite zur Last gelegten Kriegsgräuel hätten nicht stattgefunden, der Geruch an, diese Seite als die moralisch saubere gegenüber der anderen Seite zu bewahren. Eine solche Einseitigkeit von begangenen Kriegsgräueln widerspricht allerdings jeder Erfahrung. Dies gilt, darauf will ich nachdrücklich bestehen, für beide Seiten. Diejenigen, die richtigerweise die von der Nato, von Kroaten, von Bosniern, von Kosovoalbanern begangenen Kriegsgräuel anprangern, versuchen die serbischen Kriegsgräuel schlicht unter den Tisch fallen zu lassen. Damit ist niemandem gedient, außer einer Clique von Herrschenden.
Der Ausgangspunkt des Kosovokriegs stellte ganz eindeutig die Situation dar, dass die serbische Zentralregierung die Sezession des Kosovo mit brutaler Gewalt verhindern wollte. Und damit komme ich zum zweiten Problem, das die Jugoslawienkriege beleuchten: das Problem des Selbstbestimmungsrechts der Völker.
Sezession wird keineswegs als Recht etabliert, sondern politisch selektiv eingesetzt. Der Zerfall von feindlichen Staaten in einzelne Teile, die dann nicht mehr so bedrohlich wirken, wird gefördert – so der Zerfall der UdSSR und eben Jugoslawiens. Allerdings kam es sofort in etlichen Regionen, etwa von Kroatien, Bosnien und dem Kosovo, zu Sezessionsversuchen entweder durch Serben, die regional in der Mehrheit waren, oder von anderen Minderheiten. Diese Sezessionsversuche wurden mit äußerster Brutalität niedergeschlagen, und zwar von den jeweiligen Staaten, die zuvor auf ihrem Recht bestanden hatten, sich von Jugoslawien (oder Serbien) abzuspalten. Die neu formierten Nationalstaaten, die in der Gunst des Westens standen, wurden bei dieser Niederschlagung vom Westen unterstützt oder man ließ sie wohlwollend gewähren. Hier fand dann medial die so gefürchtete Opfer-Täter-Umkehr statt, indem nämlich die Sezessionisten als die Täter und die sie verfolgenden Staaten als die Opfer gelten.
Diese Überlegung zeigt, dass die schwammige Formulierung vom Selbstbestimmungsrecht der Völker kein Kriterium bietet, um den Frieden zu garantieren. Es ist, wie im zweiten Teil dieser Serie anhand der Theorie von Ludwig von Mises herausgearbeitet, nur ein bedingungsloses Sezessionsrecht, das die Grundlage des Friedens bietet. Historische und ethnische Grenzen, die angeblich das Territorium eines Staatsvolks umschreiben, sind niemals sauber zu ziehen. Wie Ludwig von Mises hellsichtig formulierte: Wenn Menschen in einem Gebiet, das sich von einem Staat losgesagt hat, nicht zu dem neu formierten Staat gehören wollen, wenn sie im alten Staat verbleiben oder einen weiteren separaten Staat bilden wollen, muss man ihnen stattgeben, sofern man an Frieden interessiert ist.
Mit diesem bedingungslosen Sezessionsrecht löst sich der Staat als territoriale Zwangseinheit schlichtweg auf. Ganz pointiert gesagt: Die Existenz des Staats an sich ist mit der Bedingung von Frieden nicht vereinbar.
Alle Gewalt äußert sich als Anspruch eines Menschen auf einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung; dies gilt für die kriminelle Handlung Einzelner, für die kriminelle Handlung einer Organisation ebenso wie für den Staat. Zu Frieden kommt es dann, wenn die Menschen einander in Frieden lassen und nur solche Verbindungen eingehen, die auf beiderseitige Zustimmung stoßen. Die oberste Bedingung des Friedens bedeutet die Anerkennung der Freiwilligkeit.
Die Frage des Pazifismus lautet, ob es Widerstand gegen Gewalt auf eine andere Weise geben kann als mit Gegengewalt.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.