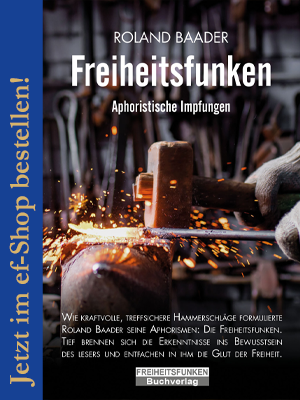Freiheit der Popkultur: And the Oscar goes to …
Transe mit fragwürdiger Moral und die Flucht aus dem schönen Nationalsozialismus hin zum bösen Kapitalismus

Es ist nun noch ein Monat bis zu den Oscars, und ich möchte Ihnen hier die zwei heißesten Anwärter kurz vorstellen. Bei der Sichtung dieser Filme ist mir wieder einmal klar geworden, dass der größte Filmpreis der Welt jedwede Existenzberechtigung verloren hat, und das sage ich als jemand, der einst alle Filme der wichtigen Kategorien geschaut, und darauf gewettet hat: Es gab also eine Zeit, in der ich bei den Oscars mitfieberte. 2025 ist auf diesem Gebiet eine absolute Enttäuschung. Bevor ich Ihnen die zwei Top-Anwärter näherbringe, muss ich Ihnen noch sagen, dass mit „Dune: Part Two“ auch ein Film nominiert ist, der so gut ist, dass er selbst in den Achtzigern und Neunzigern ein ernstzunehmender Kandidat gewesen wäre.
Film Eins: „Der Brutalist“
Handlung
Der Film erzählt die Geschichte des fiktiven ungarischen Architekten László Tóth, gespielt von Adrien Brody („Predators“, „Der Pianist“), der den Holocaust überlebt hat und nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert.
László kommt 1947 in die USA und versucht, den „amerikanischen Traum“ zu verwirklichen, indem er eine Karriere als Architekt startet. Er arbeitet jedoch zunächst im Möbelgeschäft seines Cousins in Pennsylvania.
Ein wohlhabender Industrieller, gespielt von Guy Pearce („Memento“), bietet ihm schließlich die Chance, ein gigantisches Gemeinschaftszentrum im brutalistischen Stil zu entwerfen. Dieser Auftrag nimmt jedoch über 20 Jahre in Anspruch und wird sowohl persönlich als auch beruflich zu einer enormen Herausforderung.
Es entstehen während des Auftrags sowohl moralische als auch künstlerische Konflikte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Handwerklich
Er hat handwerklich tatsächlich einiges zu bieten, denn ähnlich wie „Dune“ ist der Film richtig was für das Auge und bietet Bilder, die sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt haben. Die Darsteller funktionieren wie erwartet, und immer, wenn der Film die Architektur in den Vordergrund stellt, dann ist er brillant.
Was habe ich an ihm auszusetzen?
Nun, damit ein Film eine reale Chance auf einen Oscar hat, muss er mir, gelinde gesagt, Flausen in den Kopf setzen, und ich empfinde es als nahezu beschämend, dass ein Film über einen Mann, der den Nationalsozialismus überlebt hat, sich dann anschickt, als Kapitalismuskritik daherzukommen. Wir sehen in diesem Film, was Staaten und besonders sozialistische Staaten tun, und dennoch will er mir den Kapitalismus als das wahre Übel verkaufen. Selbst damit könnte ich leben, aber es wird ab Mitte des zweiten Akts so plakativ gemacht, dass ich mich belästigt gefühlt habe. Für diese vollkommen falsche Message hat der Film seine gesamte Raffinesse aufgegeben und es bleibt nur die Trauer über das, was er hätte sein können.
Film Zwei: „Emilia Pérez“
Kommen wir zum zweiten Film. An dem kann ich nichts Positives finden. Er ist Schmutz und es gibt ihn ausschließlich der ganzen LGBTQ+-Geschichte wegen. An dieser Stelle muss ich euch darüber informieren, dass ich mir diesen ganzen Film von über zwei Stunden angesehen habe und nicht einmal Schmerzensgeld dafür bekommen werde. Ich bin einst eine ganze Nacht mit einer gebrochenen Nase und einem völlig zerkratzten Gesicht in einem Wald umhergeirrt. Es war kalt, ich hatte Schmerzen, großen Hunger und ich war nass. Als ich „Emilia Pérez“ gesehen habe, da habe ich mich nach dieser Nacht zurückgesehnt. Nur damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ich durchgemacht habe.
Handlung
Der Film folgt Rita Moro Castro, einer angeblich überqualifizierten, aber unterbezahlten mexikanischen Anwältin, die in einer großen Kanzlei arbeitet. Diese Kanzlei ist natürlich ganz böse und voller Männer, die oft die Taten krimineller Klienten vertuschen. Während wir großes Mitleid mit dieser von Männern unterschätzten Frau haben sollen, bekommt eben jene Frau ein ungewöhnliches Angebot von Juan „Manitas“ Del Monte, einem berüchtigten Kartellboss, der sich als transgeschlechtlich identifiziert und seine Vergangenheit hinter sich lassen will, um als „Frau“ zu leben. Das allerdings sollen wir als moralisch wahrnehmen, denn dieser Mörder hat ja im falschen Körper gelebt. Manitas heuert Rita an, um ihm zu helfen, seinen Tod vorzutäuschen und eine geschlechtsverstümmelnde Operation durchzuführen. Danach nennt er sich Emilia Pérez. Nach der Operation beginnt Manitas ein neues Leben, doch die Geschichte nimmt eine Wendung, als er versucht, wieder Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen, die von seiner neuen Identität nichts weiß. Ja, genau wie in „Mrs. Doubtfire“, nur dass es weder witzig noch herzzerreißend ist. Auch ein Genie wie Robin Williams sucht man vergebens. Dann aber wird der Film noch dümmer, als er ohnehin bereits war, als uns eben jener Kartellboss plötzlich als der Gute verkauft wird. Oh, du hast getötet und töten lassen, aber dafür kannst du nichts, denn du hattest einen Penis. So in etwa hat es sich zugetragen und das war dann auch schon der gesamte Film.
Wenn Sie jetzt glauben, Sie hätten auch nur im Ansatz verstanden, was für ein dampfender Haufen Fäkalien dieser Film ist, so lassen Sie mir noch die Gelegenheit, Ihnen zuzutragen, dass alles, was ich gerade beschrieben habe, als Musical inszeniert ist. Was allerdings nicht als Anlass dazu genommen wurde, talentierte Sänger in den Cast zu nehmen.
Handwerklich
Handwerklich ist der Film genauso schlecht wie seine Handlung.
Kontroverse
Trotz des Erfolgs gab es Kritik von einigen mexikanischen Zuschauern und LGBTQ+-Kommentatoren bezüglich der kulturellen Darstellung und der Darstellung von Transen. Dass sich die Mexikaner beleidigt fühlen, kann ich verstehen, denn der Film wurde in Frankreich gedreht und behandelt Mexiko klischeehafter als „Drawn Together“. Bei den LGBTQ+-Leuten liegt es wohl eher daran, dass sie nie zufrieden sind.
Damit wurden Ihnen die beiden heißesten Oscar-Anwärter präsentiert. Falls Sie einen der in diesem Artikel erwähnten Filme sehen wollen, so empfehle ich Ihnen „Dune“. Es ist wirklich schade, was aus den Oscars geworden ist, und dass Filmemacher, die gute und beliebte Arbeit abliefern, keine Chance mehr haben, einen zu gewinnen. Ich persönlich kann es kaum erwarten, bis dieser ganze Woke-Kram vorbei ist und ich endlich wieder mitfiebern kann. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen Februar, in dem Sie Emilia Pérez nicht sehen müssen.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.