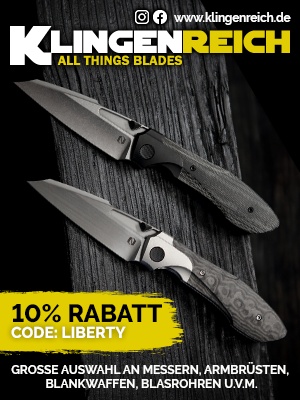Umweltschutz: Natur und Mensch
Ein Gegensatz?

Immer öfter wird in heutigen Debatten die Umwelt gegen den Wohlstand ausgespielt. Der Wohlstand ließe sich nur erhöhen, wenn dafür die Umwelt umso stärker geschädigt würde, heißt es. Daher gelte es, das kapitalistische Wirtschaftssystem zugunsten eines ökologischeren Systems zu überwinden. Das ist pikant: Denn je weiter man historisch vom Kapitalismus abwich, desto schlechter war es um die Umwelt bestellt.
Das Problem beginnt allerdings schon beim Begriff „Umwelt“. Was ist denn das überhaupt, diese Umwelt? Aufgrund der unglaublichen Fortschritte in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Kultur wurde in den Vorstellungen breiter Massen Gott als Zentrum des Universums durch den Menschen verdrängt. In diesem neuen menschenzentristischen Weltbild rückte der Mensch plötzlich in den Mittelpunkt von allem. Mit „Umwelt“ ist insofern alles um ihn herum gemeint, nur nicht er selbst. Der Mensch wurde zunehmend als etwas von der Umwelt Getrenntes betrachtet.
In mystischer Verklärung wird die Umwelt zudem gerne als eine Art handelnde Gestalt dargestellt, die mit ihren „Waffen“ wie Unwetter, Seuchen und Klimaerhitzung gegen die Menschheit aufbegehrt, die sich übernommen habe in ihrem Konsumwahn, ihrer Gier und ihrem Egoismus. Der Mensch wird damit zum Sündenbock abgestempelt. Dieser sei der Aggressor, der Ausbeuter, der Täter; die Umwelt hingegen das unschuldige Opfer. Und wir alle, die zu Sündern erklärt wurden, sollten uns gefälligst schuldig fühlen, für das, was wir sind, und für das, was wir tun.
Diese Schuldgefühle sollen dann zu einer größeren Akzeptanz derjenigen „Strafen“ führen, die selbsternannte Umweltschützer uns auferlegen wollen, wie zum Beispiel CO2-Steuern, Abgaben auf Energieträger, Verbote von Diesel- oder Benzinautos und Ölheizungen, die Ächtung derjenigen, die Kinder auf die Welt bringen, und so weiter.
Doch die Umwelt ist keine handelnde Instanz, die der Menschheit Rache schwören könnte, weil sie sich schlecht behandelt fühlt. „Umwelt“ ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Erscheinungen auf der Erde, also Tiere, Pflanzen, Steine, Meere, Luft, Wälder und so weiter. Und zu dieser Umwelt gehört eben auch der Mensch. Die Umwelt ist nicht etwas vom Mensch Getrenntes. Eine solche Perspektive verkennt die evolutionsgeschichtlichen Hintergründe: Der Mensch ist seit seiner Entstehung ein Teil der Umwelt. Er ist, soweit wir wissen, aus dieser hervorgegangen und arrangiert sich mit dieser wie alle anderen Lebewesen auf der Erde auch. Er muss konsumieren, um zu überleben. Und konsumieren kann er nur Dinge in seiner Umwelt. So sind nun mal die Gegebenheiten in der Natur, wofür der Mensch nichts kann.
Der Umwelt etwas Edles umzuhängen, während man gleichzeitig den Menschen verdammt, hat demnach etwas Absurdes. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Hass gegen den Menschen von einigen Menschen selbst propagiert wird. Doch dieses Paradoxon wird vielleicht etwas verständlicher, wenn wir bedenken, dass die behauptete Dichotomie zwischen Mensch und Umwelt für einige zu einem wichtigen Machtinstrument geworden ist. Die Macht nicht weniger Politiker hängt von der Aufrechterhaltung dieser Erzählung ab, genauso wie jener Akteure, die mit vermeintlich „grünen“ Technologien (die sich auf dem freien Markt nicht rentieren würden und die nur dank politischer Zwangsmaßnahmen zu Geld gemacht werden können) eine Art Ablasshandel versprechen.
Dabei ist es eindeutig: Je freier ein Wirtschaftssystem daherkommt, desto umweltfreundlicher ist es. Je marktwirtschaftlicher eine Ordnung ist, desto eher entstehen im kontinuierlichen Wettbewerb um die Gunst der Kunden fortlaufend Verbesserungen. Selbst große Herausforderungen können dadurch mittels unternehmerischen Handelns angepackt und überwunden werden. Gemäß dem Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek (1899–1992) zeichnet sich dieses marktwirtschaftliche „Entdeckungsverfahren“ durch das Handeln der Unternehmer, durch Versuch und Irrtum, durch das Fallenlassen gescheiterter Ansätze und die Nachahmung erfolgreicher Lösungen aus. Damit setzen sich immer höhere Lebens- und Umweltstandards durch.
Wenn man heute eine Zwischenbilanz zieht, stellt man fest, dass die Umweltverschmutzung in den letzten Jahrzehnten vor allem in den tendenziell kapitalistischen Ländern drastisch reduziert werden konnte. Die im Wettbewerb entstandenen technischen Innovationen ermöglichten es, die wirklich bedrohlichen Schadstoffe aus dem Produktionsprozess zu eliminieren. Die Schadstoffemissionen der sechs stärksten Luftverschmutzer konnten beispielsweise in den USA zwischen 1980 und 2019 drastisch reduziert werden: Schwebstaub um 63 Prozent, Stickoxid um 68 Prozent, Kohlenstoffmonoxid um 75 Prozent, Schwefeldioxid um 92 Prozent und Blei um 99 Prozent. Reduziert hat sich auch die Anzahl DER Öllecks in den Ozeanen – trotz wesentlich höheren Ölmengen, die transportiert wurden: In den 2010er Jahren flossen 95 Prozent weniger Öl in die Ozeane als noch in den 1970er Jahren. In den wohlhabenden Ländern wurde zudem das „Waldsterben“ gestoppt: 1990 bis 2015 sind die Wälder in Europa um 0,3 Prozent pro Jahr gewachsen.
Die Behauptung, mehr Wohlstand sei nur zu haben, wenn man dafür die Umwelt stärker belaste, ist falsch. Höhere Lebensstandards bedeuten nicht automatisch, dass die Menschen mehr Ressourcen verbrauchen und damit die Umwelt vermehrt schädigen. Im Gegenteil: Nur wohlhabendere Gesellschaften können sich den Umweltschutz leisten. Dass die Öko-Bewegung ihre Wurzeln gerade im reichen Westen geschlagen hat, ist kein Zufall. Die Menschen werden dort mit den lebensnotwendigen Gütern versorgt, sodass sie sich überhaupt erst Umweltanliegen zuwenden können. Wohlhabende Gesellschaften in den westlich geprägten Industrieländern fordern mit ihrem ökobewussten Konsumverhalten sauberere Produktionsmethoden ein, leisten sich Autos mit Abgasfiltern, bleifreies Benzin, Klär- und Kehrrichtverbrennungsanlagen, die Aufforstung von Wäldern, den Schutz der Artenvielfalt, Bio-Produkte und Spenden an Umweltorganisationen sowie für den Tierschutz.
Die freie Marktwirtschaft ermöglicht es zudem, immer mehr Bedürfnisse mit immer weniger Ressourcen zu befriedigen. Man denke nur einmal daran, wie viele vorherige Alltagsgeräte allein das Smartphone obsolet gemacht hat: Klobige Radios, Wecker im Umfang einer ganzen Nachttischoberfläche, Telefonkabinen und der heimische Telefonapparat, separate GPS-Geräte, gedruckte Zeitungen, dicke Lexika und Telefonbücher, Fotoapparate und Videokameras, Taschenlampen und vieles weiteres. Diese teils materialintensiven Geräte und Produkte müssen heute nicht mehr im selben Umfang oder gar nicht mehr hergestellt werden, was natürliche Ressourcen schont.
Die umwelt- und ressourcenschützenden Mechanismen der liberalen Marktwirtschaft werden von Umweltaktivisten viel zu wenig anerkannt. So schützt der marktwirtschaftliche Preismechanismus etwa knapper werdende Ressourcen: Bei sinkender Verfügbarkeit steigen die Preise und machen dadurch den Verbrauch der entsprechenden Ressource weniger attraktiv. Gleichzeitig steigt der Anreiz einer Substitution des Rohstoffs im Produktionsprozess, weil steigende Produktionskosten die Profite gewinnorientierter Unternehmen schmälern. Dadurch werden knappe Rohstoffe vor einer ungesunden Übernutzung geschützt und die Natur geschont. Ressourcenausbeutung findet vor allem dort statt, wo solche kapitalistischen Mechanismen durch Staatseingriffe verzerrt und ausgehebelt werden.
Dass heute immer noch so viele selbsternannten Umweltschützer mit ökosozialistischen Modellen sympathisieren, die in puncto Umweltbilanz wesentlich schlechter abschneiden, ist Tragik und Komik zugleich: Denn damit setzen sich diese Aktivisten nachweislich für eine Zerstörung der Umwelt ein. Umweltschutz braucht keine Bevormundung – im Gegenteil!
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.