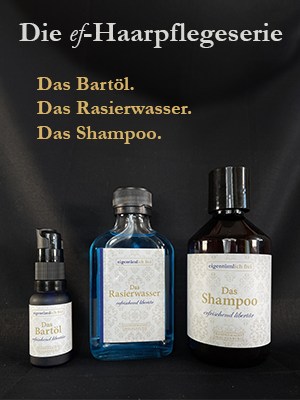Soziale Gerechtigkeit: Weder sozial noch gerecht?
Ein dreister Etikettenschwindel

Fast alle politischen Parteien haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte dem Credo angeschlossen, wonach die Politik für „soziale Gerechtigkeit“ zu sorgen habe. Darunter versteht man das Gewähren sogenannter „Anspruchsrechte“, also etwa ein Recht auf fremdfinanzierte Nahrung, Bildung und medizinische Versorgung. Keine große Partei in der Schweiz – geschweige denn in anderen westlichen Ländern – stellt den Sozialstaat prinzipiell infrage, sie unterscheiden sich nur im Umfang der geforderten staatlichen Garantien. Mit politischen Maßnahmen eine „soziale Gerechtigkeit“ herzustellen, ist allerdings von vornherein wissenschaftlich unmöglich. Denn das Ergebnis wird weder sozial noch gerecht sein.
Es ist nicht für alle gerecht, weil Gerechtigkeit etwas Subjektives ist. Darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen. In einer marktwirtschaftlichen Umgebung ohne Zwangseinflüsse des Staates verhandeln Individuen tagtäglich millionenfach darüber, was ihnen recht ist. Sie schließen nur Verträge miteinander ab, wenn das Vereinbarte im Sinne aller involvierten Parteien ist. Aus Sicht aller Beteiligten ist dies „gerecht“, weil es ihnen persönlich recht ist.
Wenn Politiker nun allerdings ihrer Klientel Privilegien im Sinne einer „kostenlosen Leistung“ verschaffen wollen, bedeutet dies notwendigerweise, dass jemand anders gezwungen werden muss, diese Leistung zu finanzieren oder ohne entsprechende Entschädigung zu erarbeiten. Dies ist so, weil etwa Wohnungen und Medikamente nicht einfach so da sind, sondern von jemandem produziert werden müssen. Diese Zwangsarbeit und dieser Raub werden vielleicht den Profiteuren recht sein, den Geschädigten jedoch nicht. Sie empfinden es als ungerecht. Eine Politik der „sozialen Gerechtigkeit“ führt also unausweichlich zu einer Ausweitung von Unrecht.
Eine „sozial gerechte“ Politik ist auch nicht sozial, weil einfach über den Willen der Beraubten und/oder zur Zwangsarbeit Genötigten hinweggegangen wird. Es findet kein sozialer Akt der zwischenmenschlichen Verhandlung statt, wie es in einer freien Marktwirtschaft der Fall wäre. Die voranschreitende Sozialdemokratisierung geht folglich mit einer Ausweitung des aggressiven und daher asozialen Verhaltens einher.
Wer tatsächlich etwas zur sozialen Gerechtigkeit beitragen möchte, darf keine Politik unterstützen, die sich diesen Grundsatz auf die Fahne schreibt, weil es sich hierbei um einen dreisten Etikettenschwindel handelt. Vielmehr sollte man sich für eine Entpolitisierung aller Lebensbereiche einsetzen, damit sich das durchsetzen kann, was Menschen friedlich und freiwillig miteinander vereinbaren, eben das, was ihnen als gerecht erscheint. Auch jenen, die auf soziale Hilfe angewiesen sind, wird geholfen: Hilfeleistungen am Nächsten bedürfen keines Zwangs, sondern sind Ausdruck echter (da freiwilliger) Solidarität.
Fragt man die Menschen unverblümt, ob sie es ethisch korrekt finden, wenn einige das Recht hätten, sich als Menschen erster Klasse aufzuspielen und Menschen zweiter Klasse Gewalt anzudrohen oder anzutun, wenn sich diese nicht an ihr Diktat halten, so verneinen fast alle – ohne die Parallelen zum aktuellen System zu erkennen. Die Dauerpropaganda in vielen Medien und an den Schulen hat es fertiggebracht, Unrecht als Recht darzustellen, indem feindliches Handeln mit einem behaupteten „Allgemeinwohl“ schöngeredet wird. Man fühlt sich unweigerlich an den Ausspruch in George Orwells 1984 erinnert: „Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist Stärke.“
Die meisten verstehen gar nicht, in welch schädlichen Klassenkampf diese Politik der „sozialen Gerechtigkeit“ letztlich mündet. Mit „Klassenkampf“ ist hier nicht der von Marx behauptete Klassenkampf im Kapitalismus zwischen Arbeitnehmern auf der einen Seite und Arbeitgebern und Kapitaleignern auf der anderen Seite gemeint, der bei genauem Hinsehen gar kein echter Kampf ist. Denn diese Gruppen arbeiten zum gegenseitigen Vorteil zusammen. Sie schließen miteinander Verträge, weil sie davon überzeugt sind, dass sie sich so beide besser stellen im Vergleich zu einer Situation, in der sie nicht zusammenarbeiten.
Der Arbeitgeber und der Kapitaleigner benötigen die Arbeitskräfte, um jene Produkte herzustellen oder jene Dienstleistungen anzubieten, von denen sie glauben, dass sie eine entsprechende Marktnachfrage stoßen werden. Behalten sie mit ihrer Prognose recht, so fahren sie einen entsprechenden Gewinn ein, der es ihnen erlaubt, noch mehr Güter und Dienstleistungen anzubieten, wovon sich die Allgemeinheit offensichtlich mehr wünscht. Dabei tragen Arbeitgeber und Kapitaleigner aber immer noch das Risiko, dass ihre Einschätzung falsch sein könnte und sie einen Verlust erleiden, den sie mit dem Verlust ihres Kapitals und ihrer Reputation bezahlen müssen.
Die Arbeitnehmer auf der anderen Seite profitieren vom Arbeitsvertrag mit dem Kapitalisten, respektive dem Arbeitgeber, weil er ihnen Kapital zur Verfügung stellt, womit ihre Arbeit produktiver, das heißt ergiebiger wird. Sie können zum Beispiel dank des Krans und des Baggers schneller ein Haus aufbauen, als sie es gekonnt hätten, wenn sie diese Hilfsmittel nicht zur Verfügung gehabt hätten. Sie hätten pro Stunde folglich wesentlich weniger verdient, als sie es dank der Hilfe des Kapitalisten taten. Ein weiterer Vorteil aufseiten der Arbeitnehmer ist es, dass sie für ihre Arbeit so oder so einen Lohn ausbezahlt bekommen, auch wenn sich das Projekt letztlich nicht rentiert. Sie tragen also nicht das Risiko der Fehleinschätzung. Sie bekommen vom Kapitalisten/Arbeitgeber also sozusagen Gelder vorgeschossen, die der Endabnehmer den Arbeitern sonst erst später (oder vielleicht auch gar nicht) bezahlt hätte.
Dieser von Marx ausgerufene und von seinen Jüngern blind übernommene „Klassenkampf“ ist also in Wahrheit gar keiner. Es ist eine freiwillige Kooperation.
Ganz im Gegensatz dazu steht ein echter „Klassenkampf“, von dem kaum je die Rede ist und der erst durch eine marxistisch inspirierte Politik der „sozialen Gerechtigkeit“ entstehen kann. Hier werden durch die Politik der Zwangsumverteilung im Wohlfahrtsstaat tatsächlich zwei Lager geschaffen: die Netto-Steuerprofiteure und die Netto-Steuerzahler. Erstere sind jene, die mehr aus dem Steuergeldtopf ausbezahlt bekommen, als sie einzahlen. Letztere sind jene, die mehr einbezahlen, als sie zurückbekommen. Die Netto-Steuerprofiteure beuten die Netto-Steuerzahler aus, denn diese beiden Gruppierungen schließen untereinander keine freiwilligen Verträge ab. Vielmehr bedroht die eine Gruppe direkt oder indirekt (mit der Hilfe der Staatsgewalt) die andere Gruppe und raubt diese aus. Weil es in einem System der „sozialen Gerechtigkeit“ eben nur einen einzigen Gewaltmonopolisten (den Staat) gibt, sind die Ausgeplünderten eine schutzlose Minderheit, die den Plünderern hilflos ausgeliefert bleibt.
Ein solcher politisch eingeführter Klassenkampf widerspricht allen Geboten einer liberalen und friedfertigen Gesellschaft: angefangen bei der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz über den Schutz des individuellen Eigentums bis hin zum Verbot von Angriffshandlungen. Auch führt eine ausgedehnte Politik der „sozialen Gerechtigkeit“ letztlich zur moralischen Korruption und zum Niedergang einer Zivilisation. Ein Land, das sich dem politischen Grundsatz der „sozialen Gerechtigkeit“ verschrieben hat – und darunter einen ausgebauten Sozial- und Umverteilungsstaat versteht –, wird über kurz oder lang implodieren, sowohl ökonomisch als auch sozial.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.