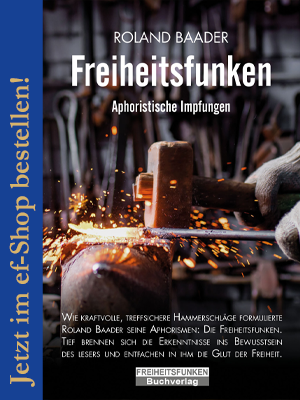Deutscher „Wohlfahrtsstaat“: Umverteilung schädigt das Wirtschaftswachstum
… und ist ungerecht

Viele Menschen entscheiden sich für den „Wohlfahrtsstaat“ und sehen im „Sozialstaat“ eine Errungenschaft, weil sie glauben, dass dieses Konstrukt nur Vorteile bringt, und sie die Kosten nicht sehen. Wenn die Menschen wüssten, dass hohe Sozialleistungen über die Zeit hinweg zu einem sinkenden Volkseinkommen führen, würde die Bevölkerung dem Sozialstaat generell kritisch gegenüberstehen. Die Politiker hätten es dann schwer, ihren Betrug zu verkaufen. Kurzfristigkeit, wie sie einer von politischen Parteien geführten Demokratie inhärent ist, fördert die Verteilungspolitik und vernachlässigt, dass die Güter produziert werden müssen, bevor sie verteilt werden können. Viele sehen nur den gegenwärtigen Vorteil und wollen nicht wahrhaben, dass die staatliche Wohlfahrtspolitik das zukünftige Wirtschaftswachstum schwächt und dadurch das Einkommensniveau in Zukunft sinkt. Die Illusion ist weit verbreitet, und wird von der politischen Maschinerie propagiert, dass die Produktion unabhängig von ihrer Verteilung sei, so dass man staatlicherseits umverteilen könne, ohne die Produktion zu schwächen.
Das Streben nach „Verteilungsgerechtigkeit“ geht auf Kosten der Leistungsgerechtigkeit. Man kann aber die Idee der Gerechtigkeit nicht einseitig auf die Verteilung beschränken, ohne in logische Widersprüche zu geraten. Die Gerechtigkeitsregeln einer Gesellschaft müssen Grundsätze enthalten, die persönliche Leistung belohnen. Die Missachtung des kommutativen Aspekts der Gerechtigkeit ist an sich schon ungerecht. Seine Vernachlässigung ist auch irrational, weil Verteilung nur möglich ist, wenn es etwas zu verteilen gibt, das heißt, dass die Produktion überhaupt stattfindet. Umverteilung ist ungerecht und ökonomisch irrational, weil sie diejenigen bestraft, die die Produktion in Gang halten. Je mehr die Umverteilung zunimmt, desto mehr zieht sich der aktive Teil der Bevölkerung aus der Produktion zurück und der Parasitismus gewinnt die Oberhand. Auf diese Weise wird die Gesellschaft unweigerlich verarmen. Am Ende werden die vom Sozialstaat Privilegierten den höchsten Preis zahlen, denn sie werden am härtesten vom wirtschaftlichen Niedergang betroffen sein.
Je mehr der Sozialstaat wächst, desto mehr nimmt die Staatsverschuldung zu. Damit findet eine der heimtückischsten Formen des Kapitalkonsums statt. Ein Defizit des Staatshaushalts bedeutet, dass das nationale Sparvolumen sinkt und das wirtschaftliche Investitionspotenzial kleiner geworden ist. In der Wirtschaftsstatistik sind die Ausgaben – ob sie nun von staatlicher oder privater Seite kommen – gleichermaßen ein Beitrag zum Sozialprodukt. Aber indem die staatlichen Ausgaben den aktuellen Empfängern der Staatsausgaben zugutekommen, fehlen diese Mittel für die Erweiterung der Produktionskapazität in der Privatwirtschaft. In dem Maße, wie die Staatsverschuldung ein Feind des Wirtschaftswachstums ist, ist sie auch ein Feind der Schaffung von Wohlstand.
Die steigende Staatsverschuldung schwächt die Dynamik des Wirtschaftswachstums. Ein schwaches Wirtschaftswachstum führt wiederum zu höheren Staatsausgaben und damit zu einer steigenden Schuldenlast. Wenn eine Volkswirtschaft ein stockendes Wachstum erlebt, steigt die Nachfrage nach Sozialleistungen noch mehr. Diese Umverteilung führt wiederum zu weniger Wachstum. Zahlreiche Länder sind in die Falle getappt, bei der Sozialausgaben die Wirtschaft schwächen und dann diese Schwäche mehr Ausgaben erfordert, was wiederum die Wirtschaft schwächt. Ein gefährlicher Nebeneffekt dieses Absturzes in eine Abwärtsspirale ist, dass die antikapitalistische Einstellung in der Bevölkerung zunimmt, da für die meisten Bürger die kausalen Zusammenhänge schwer festzustellen sind. Der Wohlfahrtsstaat und die Staatsverschuldung sind die Hauptursachen für den Rückgang der Produktivitätsraten. In den vergangenen Jahrzehnten sind die jährlichen Produktivitätssteigerungsraten der großen Industrieländer von durchschnittlich fünf Prozent in der Schlussphase auf rund zwei Prozent in den 1990er Jahren gesunken und fallen weiter ab. Die Produktivität eines Landes bestimmt das Einkommensniveau. Ohne Produktivitätsgewinne gibt es keinen Anstieg des realen Pro-Kopf-Einkommens.
Es ist vor allem deshalb wichtig, den Wohlfahrtsstaat rechtzeitig zu stoppen, weil seine negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum nicht unmittelbar sichtbar werden. Der Kapitalkonsum kompensiert für einige Zeit das schwache Wirtschaftswachstum. Wenn dies geschieht, wird es in den nationalen Statistiken noch nicht ausgewiesen. Statistisch gesehen, zählt der Konsum als Beitrag zur nationalen Produktion. Eine Steigerung des Konsums, auch wenn sie auf Kosten der Kapitalbildung geht und auf den Konsum von Kapital zurückzuführen ist, wird als Wirtschaftswachstum gezählt, obwohl dies eine statistische Illusion ist.
In der Bundesrepublik Deutschland sind die Steuereinnahmen des Bundes laufend gestiegen und haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Gleichzeitig wird der originäre Bereich der Staatstätigkeit immer mehr vernachlässigt. Die Steuereinnahmen des Staates werden sachfremd ausgegeben und es wird durchgehend schlecht gewirtschaftet. Viele Gelder versickern und Ausgaben werden parteipolitisch missbraucht. Das Steuerrecht ist immer komplizierter geworden. Ständig werden neue Steuern und Abgaben erfunden. Ungeachtet des hohen Steueraufkommens und der hohen Abgabenbelastung nimmt die Staatsverschuldung aber weiter zu. Steuer- und Abgabenpolitik ist zum Instrument der Gesellschaftspolitik geworden, in die alles hineingepackt wird, was der jeweiligen politischen Opportunität entspricht. Steuern und Abgaben dienen als Handhabe, Sondergruppen Vorteile in Aussicht zu stellen oder die eigenen ideologischen Ziele in den Vordergrund zu stellen. Politisch liegt der Grund dafür darin, dass die Parteien den Zielgruppen die Vorteilsgewährung deutlich machen können, während die tatsächlichen Kosten verdeckt bleiben. So befriedigt man zum Beispiel die vom Klima- und Umweltschutz begeisterten Wähler mit spezifischen Steuern und Abgaben auf Kosten der Interessen der Mehrheit. Die Politik reklamiert die ihr genehmen Wirkungen und unterschlägt die tatsächlichen Gegeneffekte. Man preist die angeblichen Vorteile und verleugnet die mit diesen Politiken verbundenen enormen Kosten.
Diese falschen Vorstellungen führen dazu, dass das moderne Steuer- und Sozialleistungssystem irrational und prinzipienlos geworden ist. Die Erhebung von Steuern und Sozialabgaben, wenn sie nicht bloße Willkür oder Ausdruck des politischen Machtspiels sein sollen, braucht aber Grundsätze, wobei diese Prinzipien logisch der Steuerrechtfertigungslehre entsprechen müssen.
Das Grundproblem der staatlichen Steuer- und Umverteilungspolitik besteht darin, dass weder durch Mehrheitsentscheidung noch durch Umfragen oder sozioökonomische Untersuchungen bestimmt werden kann, ob eine staatliche Maßnahme mehr Nutzen als Nachteil erbringt. Rational betrachtet, ist deshalb eine Staatstätigkeit nur dann gerechtfertigt, wenn sie einstimmig von den Betroffenen bewilligt oder freiwillig befolgt wird. Außer dem Prinzip der Eistimmigkeit und Freiwilligkeit gibt es rational keine Steuerrechtfertigung und damit keine rationale Grundlage für die Ausgabenpolitik.
Wenn keine Einstimmigkeit vorliegt, muss die jeweilige Staatstätigkeit vernünftigerweise verworfen werden. Der Grund liegt darin, dass Einstimmigkeit und Freiwilligkeit die letztlich einzig gültige Garantie sind, dass die jeweilige Ausgestaltung der staatlichen Ausgaben- und Einnahmepolitik gerechtfertigt ist. Einstimmigkeit und Freiwilligkeit bei der Besteuerung sind Gebote der allgemeinen Gerechtigkeit. Diese Einsicht hat analytisch unwiderlegbar schon vor nunmehr fast 130 Jahren Knut Wicksell (1851–1926) in seinen berühmten „Finanztheoretischen Untersuchungen“ (1896) dargelegt. Einstimmigkeit und Freiwilligkeit sind nicht nur das Kriterium für die Steuergerechtigkeit, sondern auch ein wirksamer Damm gegen die Ausgabenflut und damit gegen die um sich greifende Steuer- und Abgabenbelastung. Wenn dieser Maßstab fehlt und man der Mehrheitswahl folgt, weitet sich der Umfang der Nettoempfänger von Staatsleistungen immer mehr aus. Die damit verbundene Form der Staatstätigkeit ist nicht nur prinzipiell ungerecht, sie wird im Verlauf auch noch zunehmend ungerechter.
Die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmende Ausdehnung des Wahlrechts und die sie begleitende Herausbildung des Parteienwesens haben dazu geführt, dass der Damm gebrochen ist. Die Parteiendemokratie bringt es automatisch mit sich, dass die Politiker die Hauptlast der Steuern der besitzenden Minderheit auflegen, um Mehrheiten zu erlangen. In der Folge wird die Staatsführung in der Parteiendemokratie mit den Staatsausgaben sorglos und verschwenderisch umgehen. Je weiter diese Praxis um sich greift, desto mehr wird die Grundlage des Wohlstands untergraben. Der Sozialstaat macht arm.
Inzwischen liegt die Mehrheit, die über die Staatsausgaben entscheidet, in der Hand derer, die zu ihrer Finanzierung nichts oder nur wenig beitragen. Der Umfang der Nettozahler ist geschrumpft, während die Zahl der Nettoempfänger immer mehr gestiegen ist. Einer wachsenden Zahl von Leistungsempfängern steht eine immer geringer werdende Anzahl von Leistungserbringern gegenüber. Mit dieser Entwicklungsrichtung ruiniert sich das System von selbst und wandert unaufhaltsam dem Kollaps zu.
Im Prinzip der Einstimmigkeit und Freiwilligkeit findet die Erhebung von Steuern und Abgaben ihr einzig mögliches Vernunftkriterium. Das wechselseitige Einvernehmen über die Beschlüsse dient als Garantie gegen Ungerechtigkeit bei der Steuerlastverteilung. In diesem Licht betrachtet ist die heutige Praxis der Besteuerung willkürlich. Aber es geht nicht nur um Gerechtigkeit. Die heute übliche Form der prinzipienlosen Staatswirtschaft hält auch dem Kriterium der wirtschaftlichen Effizienz nicht stand. Ein System, das die Leistungserbringer immer schröpft, ist nicht überlebensfähig.
Knut Wicksell: „Finanztheoretische Untersuchungen“ (1896)
Antony P. Mueller: „Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie“ (2021)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.