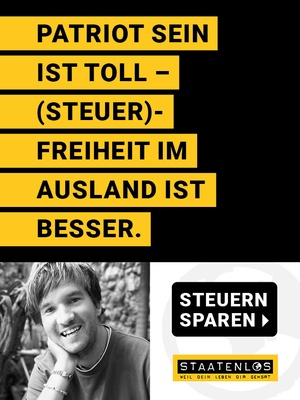Arbeitsmarkt: Würden die Angestellten ohne staatlichen Arbeitnehmerschutz von den Arbeitgebern ausgebeutet?
Ein Blick in die Geschichte

Zu Beginn der Industrialisierung dominierten in der Schweiz einige wenige Patrons das Geschehen, weil zunächst nur eine kleine Schicht die Chancen erkannte und entsprechend in den Aufbau von Firmen und Fabriken investierte. So reichte etwa das „Imperium“ des „Spinnerkönigs“ Heinrich Kunz (1793–1859), der als „größter Spinnerei-Inhaber des Kontinents“ beschrieben wurde, von Windisch im Kanton Aargau bis ins glarnerische Linthal in der Schweiz. Gerade in der zu Beginn oligopolistisch geprägten Textilindustrie herrschten im Vergleich zu heute schwierige Arbeitsbedingungen: Erwachsene und Kinder arbeiteten tags und nachts – oftmals bis zum Umfallen.
Die Politik versuchte aus diesen schwierigen Umständen Kapital zu schlagen und sich als Retter in der Not aufzuspielen. Die Zürcher Regierung erließ im Jahr 1837 die wegweisende Verordnung zum Schutz der schulpflichtigen Kinder. 1864 führte der Kanton Glarus als erster Kanton der Schweiz ein Fabrikgesetz ein, in dem die tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden begrenzt sowie die Kinderarbeit verboten wurden. Auch wurden gewisse Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz vorgeschrieben. Andere Kantone zogen bald nach, bis 1877 das erste eidgenössische Fabrikgesetz erlassen wurde: Von nun an war der Elf-Stunden-Tag gesetzlich besiegelt und eine Anstellung von unter 14-Jährigen untersagt.
Aus diesen geschichtlichen Entwicklungen schließen viele, dass die Fortschritte auf dem Gebiet der Arbeitsstandards allein aufgrund staatlicher Befehle erreicht wurden und auch heute immer noch unmenschliche Arbeitsbedingungen aufgrund der Einführung des Kapitalismus herrschen würden, wenn keine entsprechenden Regulierungen erlassen worden wären. Doch das ist ein großer Irrtum. Erstens wäre es eine Illusion anzunehmen, dass vor der Industriellen Revolution, die als Geburtsstunde des Kapitalismus gilt, nicht ebenfalls schlechte Arbeitsbedingungen geherrscht hätten. Der Wirtschaftshistoriker Eli Heckscher schrieb etwa: „Die Vorstellung, dass Kinderarbeit in Theorie und Praxis das Ergebnis der Industriellen Revolution war, steht im diametralen Gegensatz zur Realität. Im Merkantilismus war es ein Ideal, Kinder fast ab dem Zeitpunkt arbeiten zu lassen, in dem sie laufen konnten. Zum Beispiel führte der Finanzminister König Ludwig XIV. Geldbußen für Eltern ein, die die Kinder nicht zur Arbeit brachten.“
Dank der Industriellen Revolution wurden den Arbeitern, die unter schwierigsten Bedingungen in der Landwirtschaft schufteten, neue Jobalternativen geboten. Die Tatsache, dass viele von ihnen auf der Suche nach besseren Lebensstandards in die neuen Fabriken flüchteten, spricht Bände.
Zweitens ist es ist nicht staatlichen Schutzvorschriften zugunsten der Arbeitnehmer zu verdanken, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessert haben. Allenfalls hatten diese eine sich ohnehin schon abzeichnende Entwicklung zeitlich etwas vorweggenommen. Ohne die im Wettbewerb entstandenen Innovationen des freien Markts hätte es aber niemals zu besseren Standards kommen können. Wer meint, man könne höhere Standards einfach gesetzlich verordnen und dadurch herbeizaubern, verkennt grundlegende ökonomische Gesetze. Andernfalls würde ja nichts dagegensprechen, dass man alle Menschen weltweit aus der Armut befreit und sie per gesetzlichen Befehl zu Millionären macht.
Es wäre in den ärmlichen Verhältnissen der vorkapitalistischen Zeit töricht und unmöglich gewesen, Kinderarbeit zu verbieten, weil dadurch viele zu wenig verdient hätten, um die ganze Familie zu ernähren. Sie wären schlichtweg verhungert. Genauso wäre es wohl zum Nachteil der hiesigen Arbeiter gewesen, zu Beginn der industriellen Umwälzungen eine Höchstarbeitszeit einzuführen, zumal man damit den so wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Nationen verloren hätte und die Arbeitsplätze rasch in andere Länder abgewandert wären. Dies hätte den Schweizer Arbeitern zwar missliche Arbeitsbedingungen erspart, hätte ihnen jedoch auch ihre Lebensgrundlage entzogen. Auch wäre es undenkbar gewesen, zu dieser Zeit einen gesetzlichen Mindestlohn vorzuschreiben, der über den marktüblichen Löhnen liegt, weil niemand diese Löhne hätte zahlen können. Die neuen Fabrikunternehmer mussten sich erst behaupten, indem sie sich laufend steigerten, ihre Produktivität erhöhten und somit eine „Pole-Position“ auf dem Weltmarkt einnahmen. Erst diese Gewinne ermöglichten es, die hiesigen Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Historisch war es denn auch so, dass sich Innovationen und bessere Bedingungen am Arbeitsplatz zunächst bei einigen Unternehmen etablierten, die durchaus ein nicht uneigennütziges Profitmotiv verfolgten und mit solchen Maßnahmen die besten und talentiertesten Arbeiter anlocken wollten. Dies geschah vor allem dann, als immer mehr Arbeitgeber für steigende Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sorgten und die Arbeiter damit mehr Wahlmöglichkeiten erhielten. Die Konkurrenz sah sich schließlich gezwungen, ebenfalls bessere Standards anzubieten, um ihrerseits wiederum Arbeiter für sich zu gewinnen. Taten sie dies nicht, wanderten immer mehr Angestellte zur Konkurrenz ab und ihr Betrieb wurde arbeitsunfähig. So breiteten sich die höheren Standards immer weiter aus, ohne dass dafür irgendwelche Regulierungen vonnöten gewesen wären.
Erst als eine genügend große Anzahl von Konkurrenten nachzog und die Standards zu einem bedeutenden Teil bereits auf dem freien Markt eingeführt waren, wurden entsprechende Regulierungen eingeführt, die diesen Standard auch gesetzlich für verbindlich erklärten. Die Arbeitnehmerschutz-Gesetzgebung ist deshalb Folge, nicht Ursache der sich verbessernden Arbeitsbedingungen.
Staatliche Arbeitnehmerschutzmaßnahmen sind nicht nur wirkungslos und verleihen dem Staatsapparat einen täuschenden Ruf als vermeintliche Triebkraft des Fortschritts, sondern haben auch ungewollte Nebenwirkungen, die gerade denjenigen schaden, die man besonders schützen möchte. Ein ausgebauter Kündigungsschutz beispielsweise – sagen wir ab einem Alter von 55 – würde dazu führen, dass ältere Arbeitnehmer von Arbeitgebern weniger berücksichtigt würden, weil diese sich eine gewisse Flexibilität bewahren möchten. Übertriebene Sicherheitsstandards führen zur Schließung oder Nichtentstehung von Unternehmen und Arbeitsplätzen, weil dadurch gewisse Angebote und Firmen unrentabel werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn die staatliche Regulierung Standards festlegen will, die höher sind als jene, die sich bereits auf dem freien Markt durchgesetzt haben.
Arbeitnehmerschutzgesetze sind deshalb nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf solche Gesetze zu verzichten, um damit den nützlichen Wettbewerb zwischen den Arbeitgebern nicht zu behindern, aus dem laufend bessere Arbeitsbedingungen hervorgehen.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.