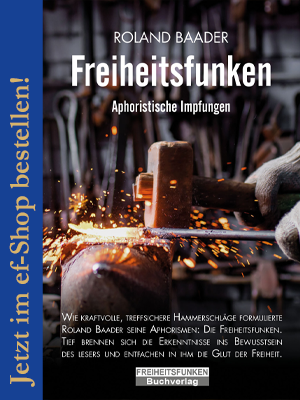Was ist das eigentlich?: Der gesellschaftliche Zusammenhalt
Und wodurch wird er gefährdet oder gar zerstört?
von Christian Paulwitz drucken
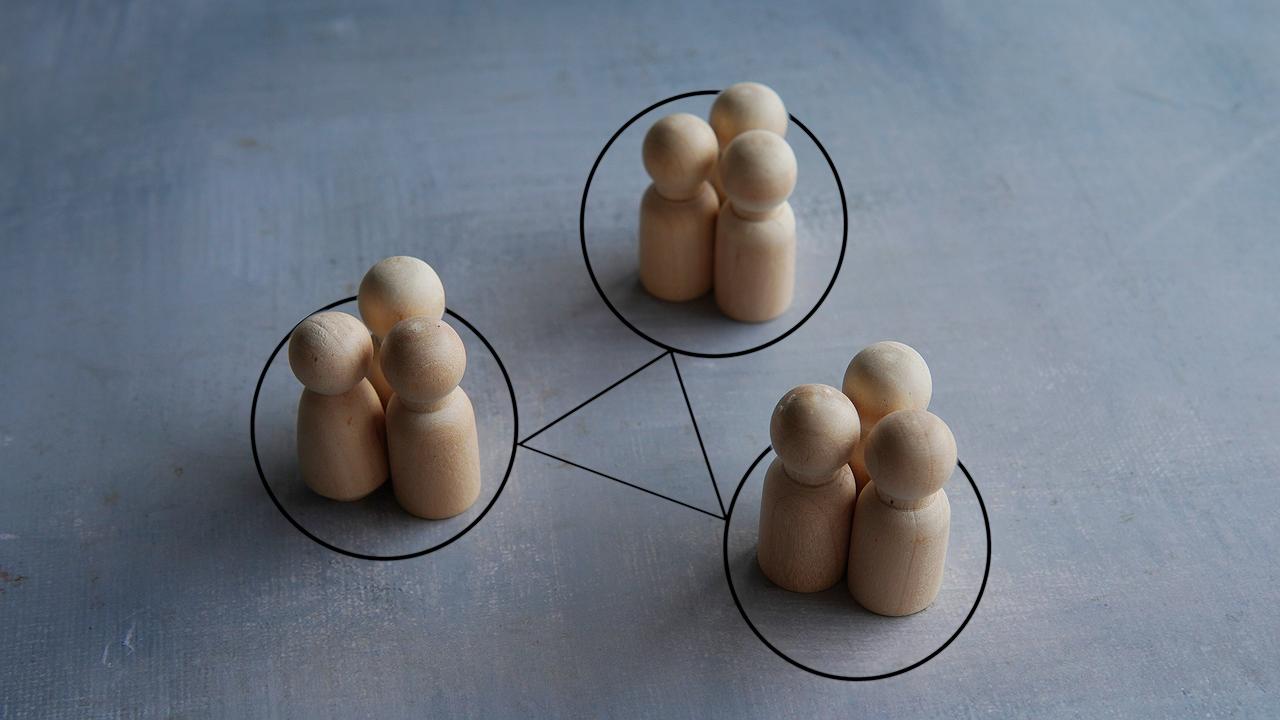
Eine der häufig bemühten Standardphrasen unserer Zeit ist die des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der entweder gefordert wird oder gefördert werden soll. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen? Schließlich ist „die Gesellschaft“ eine Abstraktion und keine konkrete Gruppe von Menschen. Ist es angesichts dessen überhaupt sinnvoll, von einem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sprechen?
Vielleicht. Versuchen wir es uns vorzustellen, indem wir „die Gesellschaft“ aus einer Vielzahl handelnder Menschen verstehen, die gelegentlich tatsächlich miteinander interagieren oder zumindest mehr oder weniger zufällig mittelbar oder unmittelbar vorübergehend miteinander in Beziehung treten können. Freiwillig oder auch zwangsweise.
Stellen wir uns ein friedliches Dorf vor, zu irgendeiner Zeit im Irgendwo, mit Familien, Handwerkern, Bauern, einem Lehrer, Arzt und was man sich sonst noch so an nützlichen Berufen denken kann. Jeder ist auf seine Weise einen Teil seiner Zeit produktiv tätig, organisiert in kleinen Gemeinschaften, und kann aus den Früchten seiner Arbeit und mit Hilfe des Mittler-Guts Geld mit praktisch allen anderen je nach seinen Bedürfnissen in Austausch gehen – oder auch nicht, wenn es seine Bedürfnisse nicht erfordern. Die Älteren haben sich aus ihren früheren aktiven Lebensjahren einen Kapitalstock geschaffen, aus dem sie ihre Bedürfnisse decken können. Letztlich braucht jeder in jeder Lebenslage ab und zu Dinge, die er von anderen im Tausch beziehen kann, weil er diese nicht selbst oder andere in derselben Zeit besser herstellen können, und so schätzt jeder die Arbeit des anderen auch dann, wenn er gerade nichts von ihm benötigt. Die Erfahrungen sind geprägt vom Nutzen friedlicher Kooperation.
Dabei sind die Menschen dieser kleinen Gesellschaft höchst unterschiedlich. Einige sind sehr fleißig, sparen und erwerben Kapitalgüter, um noch mehr produzieren und anderen gegen Tausch zur Verfügung stellen zu können. Andere genießen lieber mehr Mußezeit und sind dafür etwas genügsamer. Der eine mag die Lebensweise des anderen je nach eigenen Werten gutheißen oder auch mal die Nase rümpfen. Doch jeder kann auf eigene Kosten so leben, wie er es für richtig hält, denn es tut ja einem anderen nicht weh.
Freilich gibt es auch in dem friedlichen Dorf immer wieder Konflikte. Auch wenn Eigentumsrechte allgemein respektiert werden und nicht diskutiert werden müssen, so gibt es doch Grenzfälle, die nicht von vornherein eindeutig sind. Tätigkeiten, die beispielsweise Lärm entwickeln und, wenn nicht nur ausnahmsweise und zu begrenzten Zeiten erfolgen, dabei andere beeinträchtigen; Nutzung von Land oder anderen Ressourcen, bei denen vorher keine älteren Rechte erkennbar waren, aber dann doch mit Begründung geltend gemacht werden können; Vorfälle, in denen Güter oder Personen zu Schaden gekommen sind, aber über die Verantwortung dafür sowie Kompensationsansprüche unterschiedliche Auffassungen bestehen, oder die Leistungsfähigkeit des Verantwortlichen nicht ausreicht.
Die Schlichtung solcher Konflikte übernimmt ein Ältestenrat – Männer und Frauen, die für ihre Weisheit in Fragen des Rechts, ihre Besonnenheit und Unabhängigkeit allgemein respektiert sind und daher in ihre Funktion berufen worden sind. Da die Lösung von Konflikten in einem fairen Ausgleich von allgemeinem Interesse ist und die Schlichtersprüche nach ausgiebiger Beratung und Abwägung verkündet werden, so werden sie in der Regel von beiden Parteien akzeptiert und auch von allen anderen anerkannt.
Auch in den Fällen, in denen sich Menschen unlauter verhalten, durch Täuschung oder Diebstahl andere übervorteilen, können die Sachverhalte vorgebracht werden und es finden sich Lösungen für angemessene Kompensation und Sanktionen, die von unbeteiligten Dritten als angemessen und gerecht gesehen werden.
In dem Dorf, das wir uns vorgestellt haben, könnte man sicher von gesellschaftlichem Zusammenhalt sprechen. Es gibt allgemein akzeptierte und für alle geltende Regeln, wie man miteinander umgeht, basierend auf Recht, das immer aus Eigentumsrechten besteht. So fühlt sich niemand unangemessen eingeschränkt. Einige Menschen organisieren sich, um anderen, die aufgrund von Unglück oder Krankheit in Notsituationen geraten sind, Unterstützung zukommen zu lassen – niemand stellt Hürden auf, dies zu behindern. Die notwendigen Mittel werden von vielen anderen freiwillig mitgetragen. Wer die Unterstützung aufgrund eigener Kraft nicht nötig hat, der würde sie auch nicht bekommen, da sich die freiwillig Organisierten nicht nachsagen lassen würden, verschwenderisch mit den Mitteln anderer Hilfsbereiter umzugehen. Andererseits sind die, denen auf diese Weise wieder auf die Beine geholfen wurde, dankbar und versuchen – wenn sie nicht schon vorher ideell oder materiell mitgewirkt haben –, im Nachhinein die Unterstützung zu kompensieren – Ehrensache. Die Gesellschaft hält zusammen. Niemand erhebt Ansprüche auf Leistungen eines anderen ohne Gegenleistung – und wenn es nur der Dank in der Not ist. Neben dem Dorf gibt es weitere ähnlich organisierte Dörfer, mit denen man in friedlichem Austausch steht. Und diese wiederum mit anderen und so weiter.
Ertappte Diebe, zu deren Ergreifung jeder sonst im Dorf bei Bedarf Hilfe leistet, müssen Kompensation leisten, je nach Schwere mit entsprechendem Zuschlag, in sehr schweren Fällen mit Verjagen aus dem Dorf. Doch als einige Diebe das Dorf für sich entdecken, sich zusammentun und immer wieder Schaden verursachen können, ohne dass eine Abwehr möglich ist, werden neue Wege gefunden. Man tut sich zusammen und bezahlt nun eine kleine Truppe, die sich als Dienstleistung dem Eigentumsschutz der anderen widmet. Das bewährt sich über einige Zeit, und man gewöhnt sich daran und sieht die Bezahlung als gut angelegtes Geld, das auch genügend Leute auszugeben bereit sind.
Allerdings entwickelt die Truppe nach und nach ein vom Dorf abgekoppeltes Selbstverständnis. Anlässe aller Art dienen dazu, mehr Personal, Material und Bewaffnung zur Ausstattung der Truppe zu fordern. Da die Bitten zunächst verständig vorgebracht werden, gewährt man sie auch gerne, zumal das Dorf durch seine produktive Aufstellung recht wohlhabend ist.
Diese anfängliche Bequemlichkeit führt schließlich dazu, dass die Truppe nach einiger Zeit so stark wird, dass sie anfängt, selbst Regeln aufzustellen. So sollen alle im Dorf, die letztlich ihren Schutz genießen, zu ihrer Finanzierung gezwungen werden. Das sei nur gerecht, so sagt die Truppenführung. Als sie sich daran macht, die neu ausgerufene Regel mit zunächst sanftem Druck durchzusetzen, erheben sich Klagen und der Ältestenrat weist das Konzept zurück. Doch die Truppe will sich damit nicht zufriedengeben und ist mittlerweile aufgrund ihrer Ausstattung und Wehrerfahrung dem Rest des Dorfes offenkundig überlegen, ja wäre wahrscheinlich in der Lage, Forderungen auch gewaltsam durchzusetzen, auch wenn sie sich bisher noch kein Gewaltmonopol gesichert hat. Doch ihr Anführer ist ein kluger Mann und will den offenen Bruch vermeiden.
„Wir müssen unsere Politik besser erklären“, meint er, und als sich die Wogen geglättet haben, setzt er durch, dass die Truppe eine Position im Ältestenrat, der ihre Anliegen bisher ja nicht verstehen könne, besetzen darf. Welche Person dies dann sei, möge das Dorf aus den Kandidaten der Truppe auswählen. Der Ältestenrat sieht dies anders und will an den bewährten Strukturen festhalten, aber die Dörfler wollen ihre Ruhe haben und die Truppe nicht verärgern, die schließlich die Mittel hat, sich durchzusetzen, auch wenn man vermeidet, sich das einzugestehen. Einige Mitglieder des Ältestenrats treten von ihrer Position zurück, aber andere arrangieren sich mit dem Willen der meisten Dörfler. Die Strukturen verändern sich, aber die meisten nehmen es hin, nur wenige warnen von Anfang an vor den kommenden Entwicklungen.
Irgendwann ist es soweit, dass die Zwangsabgaben zur Finanzierung des Truppenapparats nun doch durchgesetzt werden. Trotzdem sind es inzwischen mehr geworden, die damit nicht einverstanden sind, sich aber nicht durchsetzen können. Um die Politik noch besser zu erklären, werden die Mittel erhöht, die sich die Truppe durchzusetzen genehmigt, um geeigneten Personen Vergünstigungen zukommen zu lassen. Nach und nach müssen immer mehr zunehmend unproduktive Menschen bedacht werden, um dem größer werdenden Murren entgegenzuwirken. Da weniger produziert wird und die weniger werdenden Produzenten immer stärker – nunmehr zwangsweise – zur Kasse gebeten werden, während immer mehr Leute teilweise oder ganz von Vergünstigungen leben, wird der Mangel größer und das Dorf unzufriedener. Neid und Missgunst nehmen dabei zu. Der Zusammenhalt der Dorfgesellschaft ist zunächst ge-stört, und nach und nach zer-stört.
Anlass dieser Kolumne: Letze Woche hörte ich aus einem zwangsfinanzierten Medium einen Bericht über eine von politischen Unternehmern aus Zwangsabgaben finanzierte „Untersuchung“, die zum Befund kam, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestört sei, und politischen Unternehmern Empfehlungen gab, wie damit umzugehen sei.
Sie verhöhnen uns. Täglich. Schamlos.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.