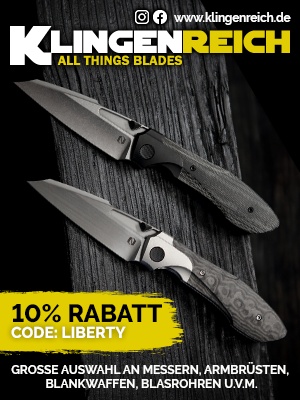Arbeitsmarkt: Ist „Lohndumping“ tatsächlich schädlich?
Ein etwas umfassenderer Blick

Neu auf den Arbeitsmarkt eintretende „billige“ Arbeitskräfte werden von vielen Politikern und Gewerkschaften gern als Bedrohung dargestellt. Der Vorwurf: Jene, die zu tieferen Löhnen zu arbeiten bereit sind, betrieben „Lohndumping“. Dadurch nähmen sie den bisherigen Arbeitern etwas weg, was diesen zustünde: und zwar entweder ihren Job, den sie an die „billige“ Arbeitskraft verlieren, oder die bisherige Gehaltshöhe, die sie auf das Niveau der Billigarbeitskräfte herunterschrauben müssten, um den Job behalten zu können.
Oftmals verschwimmen hier ökonomische Unkenntnisse mit ausländerfeindlichen Ressentiments, zumal es sich bei den Arbeitskräften, die sich auch mit tieferen Salären zufriedengeben, oft um Einwanderer aus Ländern mit tieferen Lohnniveaus handelt. Der Frust über Ausländer, die uns hier angeblich die Stellen „wegnehmen“, macht uns blind für das größere Bild.
Schauen wir uns die verschiedenen Einwände der Reihe nach an: Es wird zum Beispiel fälschlicherweise behauptet, dass der gesamtgesellschaftliche Wohlstand durch „Lohndumping“ sinke, weil das Lohnniveau insgesamt verringert werde und die Arbeiter damit weniger Geld verdienten, womit weniger für den Konsum ausgegeben werden könne. Werde weniger Geld ausgegeben, leide darunter die Wirtschaft. Oftmals wird dabei von einer „Nivellierung nach unten“ gesprochen, also zum Schlechteren. Die Einwanderungsländer mit den höheren Lohnniveaus müssten sich dann gezwungenermaßen an die Auswanderungsländer mit niedrigerem Lohnniveau anpassen, weshalb bald überall die schlechteren Standards gelten würden. Wohlstand ginge also aus Sicht des Einwanderungslands verloren, weil Armut importiert würde.
Was an diesem Vorwurf stimmt, ist die Tatsache, dass das Lohnniveau in den betroffenen Sektoren unter Druck gerät. Denn je mehr Arbeitskräfte zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe zur Verfügung stehen, desto tiefer ist der Marktlohn. Das bedeutet nun aber nicht, dass es den Betroffenen – geschweige denn der Gesellschaft als Ganzes – deswegen schlechter gehen müsste. Denn wenn es Leute gibt, die eine bestimmte Aufgabe zu tieferen Löhnen bewältigen, bedeutet dies, dass die Produktionskosten dadurch sinken – und damit auch die Preise der betroffenen Produkte und Dienstleistungen. Diese Güter und Leistungen werden also für alle erschwinglicher. Man kann sich entweder mehr davon leisten, oder aber deren Erwerb beansprucht einen geringeren prozentualen Anteil des eigenen Budgets, weswegen man insgesamt mehr Bedürfnisse befriedigen kann: Der Lebensstandard der Menschen ist gewachsen, weil die Kaufkraft der Menschen gestiegen ist. Zentral ist nicht die nominale Summe, die die Arbeiter verdienen, sondern was sie sich damit leisten können. Es ist keine Tragik, wenn wir auf dem Papier weniger Lohn bekommen, wir uns aber mit diesem geringeren Lohn dafür mehr leisten können.
Dies gilt auch für die vom „Lohndumping“ direkt betroffenen Arbeitskräfte. Auch sie profitieren von tieferen Preisen, was die erlittenen Lohneinbußen wieder wettmachen kann. Zudem steht es den Arbeitskräften in Tieflohnsektoren frei, sich weiterzubilden und sich neue Fähigkeiten anzueignen, die ihnen auf dem Arbeitsmarkt mehr Einkommen einbringen.
Heute ist eine solche Weiterbildung so kostengünstig wie noch nie: Es braucht lediglich einen Internetanschluss und ein internetfähiges Gerät – und schon hat man Zugang zu einem schier unendlichen Wissensfundus in Form von E-Books, Tutorial-Videos und Lernprogrammen. Man will sich zum Beispiel eine Programmiersprache aneignen, ein Instrument spielen lernen oder ein Online-Business aufziehen? In den gigantischen Datenbanken wird man garantiert fündig. Umschulung, Weiterbildung und Spezialisierung sind heute in den meisten Fällen nur noch eine Frage des Willens.
Dieser Prozess des ständigen Lernens und Sich-Weiterentwickelns ist die Grundlage unseres heutigen Wohlstands. Hätten unsere Vorfahren immer nur dasselbe getan, was sie schon immer getan hätten, würden wir heute noch in Höhlen leben. Es gibt also kein „Recht“ darauf, die Stelle, die man aktuell innehat, sein Leben lang behalten zu dürfen und nie etwas dazulernen zu müssen. Die Bedürfnisse der Gesellschaft wandeln sich laufend, und es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sich daran anzupassen und seinen Mitmenschen Dinge anzubieten, die diese schätzen und freiwillig kaufen wollen.
Und wenn jemand die gleichen Dienste besser, kostengünstiger oder kundenfreundlicher anbieten kann, so hat man das eben zu akzeptieren und nicht den Staat zu Hilfe zu rufen, der die anderen unter Androhung oder Anwendung von physischer Gewalt davon abhält, produktiv tätig zu sein. Ein solches Verhalten ist unethisch und inakzeptabel, weil ich so auf Kosten anderer zu unverdienten Einnahmen komme (win-lose). Moralisch einwandfrei wäre es hingegen, selber besser zu werden, mit den eigenen Kunden, wenn möglich, eine Beziehung aufzubauen oder die eigenen Produkte zu optimieren oder neue Produkte zu erfinden, die die Mitmenschen schätzen und freiwillig nachfragen, um so den eigenen Lohn zu erhöhen (win-win).
„Lohndumping“ wird manchmal auch aus anderen Gründen kritisiert. Es wird zum Beispiel behauptet, dass das Auswanderungsland darunter leide, wenn ihre Bürger auswanderten. Damit würden dort wichtige Arbeitskräfte wegfallen und der Wohlstand würde absinken. Wenn wir es erlauben würden, dass hier jemand „Lohndumping“ betreibe, würden wir folglich gleichzeitig die Leute bestrafen, die im Auswanderungsland ansässig blieben. Das sei unsozial.
Doch auch diese Argumentationsweise hinkt. Denn nur wenn es die Möglichkeit der Migration gibt, kann der politische Wettbewerb effektiv spielen. Wenn Leute „mit den Füßen abstimmen“, also einem Land den Rücken kehren, weil die dortigen Bedingungen weniger gut sind als in einem anderen Land, stellt dies für die politischen Herrscher in jenem Land, in dem es zur Abwanderung kommt, einen Anreiz dar, die dortigen Bedingungen zu verbessern. Gäbe es diesen Mechanismus der potenziellen Wanderung nicht, würden Politiker kaum je etwas zur Verbesserung der jeweiligen Rahmenbedingungen unternehmen. Sie wären keinem echten Wettbewerb ausgesetzt und könnten ihre Bevölkerung nach Belieben wie eine Zitrone auspressen.
Wenn es jedoch zur Abwanderung von Steuerzahlern kommt, ist das für die politischen Eliten im Land ein klares Signal: Wenn wir unsere Rahmenbedingungen nicht verbessern, entgehen uns Steuereinnahmen. Politiker haben also einen Anreiz, Steuern auf ein für die Bürger angenehmeres Niveau herabzusenken und Regulierungen aufzuheben, die unnötigerweise das Unternehmertum und den Wohlstand behindern.
Wenn als Reaktion auf die Abwanderung im betroffenen Land Steuern gesenkt und freiere Rahmenbedingungen installiert werden, profitiert davon auch die dort ansässige Bevölkerung. Einerseits wird sie so selbst weniger in ihrem Tun behindert und ein unternehmerisches Engagement lohnt sich wieder. Andererseits lockt man durch liberale Rahmenbedingen auch mehr ausländische Investitionen und Unternehmen an, die sich im Land niederlassen und neue Arbeitsplätze schaffen, weshalb der Wohlstand steigt. Freie Migration und ein funktionierender politischer Wettbewerb sind für die Bürger aller Länder deshalb von Vorteil.
Es ist also große Vorsicht geboten, wenn Politiker den zu Unrecht negativ geprägten Begriff des „Lohndumpings“ missbrauchen, um eine restriktive Ausländerpolitik oder illiberale Abschottungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt durchzudrücken. Lohndumping erhöht unseren Wohlstand.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.