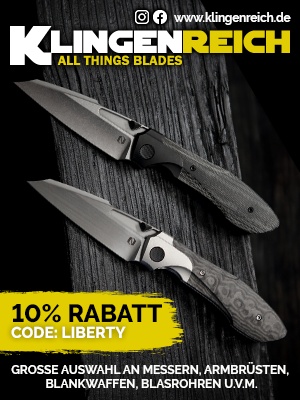Libertäre Philosophie – Teil 1: Sokrates: Der Kampf der Mehrheit gegen die Wahrheit
Der libertäre Auftrag der abendländischen Philosophie
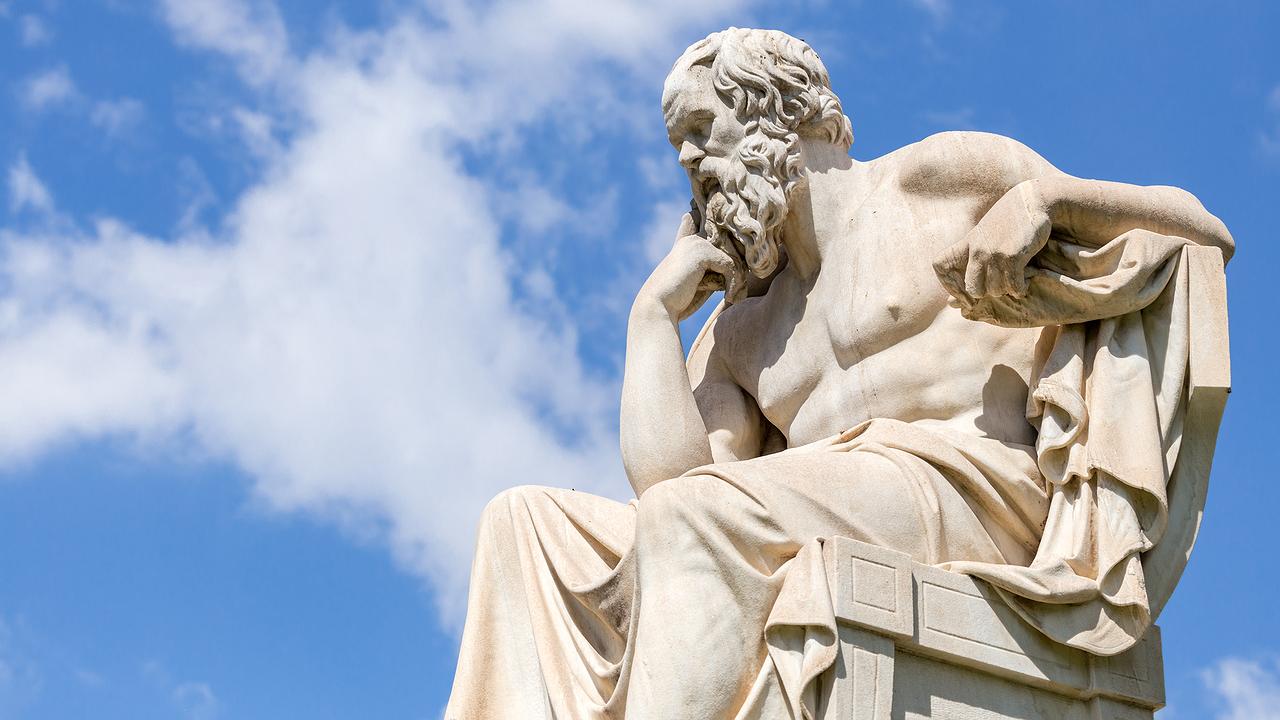
Sokrates. Schauplatz Athen 469 bis 399 vor Christus: Die abendländische Philosophie hebt mit einem Paukenschlag an. Dem Paukenschlag gegen Dogmatismus und Tyrannei. Diese Tyrannei und dieser Dogmatismus aber gingen von einem demokratischen Gemeinwesen aus. Ein Gericht mit durch Los bestimmten 501 Geschworenen verurteilte den ersten Philosophen, Sokrates, weil er unbequeme Fragen gestellt habe und damit die Jugend verderbe, zunächst mit knapper Mehrheit. Dem Brauch zufolge wurde er gefragt, welche Strafe er für sich angemessen halte. Er antwortete, seiner Verdienste wegen würde es eher angemessen sein, ihm die Ehre zukommen zu lassen wie einem Olympiasieger. Einen faulen Kompromiss, dass man ihn laufen ließe, falls er sich verpflichtete, das Philosophieren – die öffentliche Frage danach, was wahr und recht sei – einzustellen, lehnte er ausdrücklich ab. Diese Provokation erboste die Geschworenen derart, dass ihn nun eine satte Mehrheit zum Tode verurteilte.
Ohne etwas Weiteres über die Lehre des Sokrates zu wissen, erhellt diese Szene allein schon das Thema, das die nächsten Jahrtausende bis heute aktuell geblieben ist: auf der einen Seite das Gemeinwesen mit seinen Gesetzen und seinem Anspruch auf Konformität, auf der anderen Seite das Aufbegehren des Individuums, das die herrschenden Gebräuche kritisch hinterfragt. Es ist, es war und es bleibt ein ungleicher Kampf zwischen denen, die die Gewalt innehaben – die bewaffnete Gewalt der Schergen des Staats ebenso wie die Gewalt der schieren Masse des Pöbels, der den Kopf des Abweichlers fordert –, und demjenigen, der sich der Gewalt entgegenstellt.
Obwohl sich zu allen Zeiten das natürliche und spontane Gerechtigkeitsempfinden über die Verurteilung des Sokrates, der keiner Fliege etwas zuleide getan hatte, empört(e), bleibt Sokrates der Stachel im Fleisch aller Philosophen, die etwas auf die Konstitution des Gemeinwesens – oder genauer: des Staats – geben. Sokrates ist nicht aufgrund des willkürlichen Urteils eines unwissenden oder launischen Potentaten gestorben. Er wurde nach Recht und Gesetz in einem ordentlichen und demokratischen Verfahren dem Tod anheimgestellt. Nichts ist an dem Verfahren auszusetzen. Mehr noch: Hat der Staat nicht das Recht, ja sogar die Pflicht, sich und die ihm treu ergebenen Bürger gegen Zersetzung und Delegitimation zu schützen? Über Jahrhunderte waren es vor allem die Religionen (und manche sind es zurzeit immer noch), die genau der Argumentation des Athener Gerichts folgen: Wer unbequeme Fragen stellt, wer zu erkennen gibt, nicht ohne Weiteres zu allem Ja und Amen zu sagen, was die Priester und andere berufene Führer des Gemeinwesens von sich geben und als Wahrheit verkünden, der bedroht das Volk, der bedroht den Glauben, der bedroht vor allem die zarte Jugend, die doch noch anfällig und formbar ist. In den Kernstaaten der Demokratie hat heute die Wissenschaft die Rolle der Religion übernommen: Das, was die Wissenschaft sagt, darf nicht hinterfragt werden. Auch darf nicht hinterfragt werden, ob denn die Wissenschaft mit einer Zunge spreche und wie ihr angeblicher Konsens zustande komme.
Das Menschen- und Wahrheitsbild, das von dem Athener Gericht bis heute alle Verfolger der Wahrheit inthronisieren, lautet: Die Wahrheit ist fragil. Die Menschen tendieren natürlicherweise zum Falschen und zum Bösen. Wenn sie nur dem geringsten Zweifel ausgesetzt werden, wenn jemand nur eine einzige unbequeme Frage stellt, fallen sie sofort vom Glauben ab. Mit Gewalt – in diesem Falle: mit der Hinrichtung des Fragenstellers – müssen die Menschen davor geschützt werden, zum eigenen Schaden von der Wahrheit abzuweichen. Daraus ergibt sich das Paradox, dass, um die Wahrheit zu schützen, derjenige verfolgt werden muss, der nach der Wahrheit fragt. Der Philosoph ist per se der Subversion verdächtig. Wir haben hier die beiden Wahrheitsbegriffe in Reinkultur, die immer noch gültig sind und miteinander im Kampf liegen:hie die Wahrheit als von der Gewalt verkündet und mit Gewalt zu verteidigen, dort die Wahrheit als Frage, als etwas, das gesucht werden muss. Dass Sokrates bis heute fasziniert, ist der Triumph der Philosophie über die Gewalt der Mehrheit.
Und doch gibt es auch bei der Geschichte um Sokrates eine Hintertür für die Propagandisten der Gewalt. Warum ging Sokrates nahezu freiwillig in den Tod? Der Überlieferung nach hätte er fliehen können. Freunde boten dem alten Mann ihre Hilfe an. Unabhängig von dem Problem, ob er zur Flucht körperlich in der Lage gewesen wäre, ob es möglich gewesen wäre, die Wachen zu überwinden, ob Sokrates sich im Exil hätte zurechtfinden können, sagt die Überlieferung, dass er das Ansinnen an sich abgelehnt habe, und zwar mit dem Hinweis, dass man zwar versuchen könne, ungerechte Gesetze (oder Urteile) zu verändern, sie aber nicht übertreten dürfe, weil das den Staat (oder das Gemeinwesen) gefährden würde. War Sokrates doch so etwas wie ein Rechtspositivist, der meinte, man müsse Gesetze, egal, wie ungerecht sie seien, befolgen? Es gäbe kein Widerstandsrecht?
Nun, die Überlieferung erfolgte durch Platon, den ich in Folge 3 behandeln werde. Er verfolgte eine von Sokrates radikal verschiedene Philosophie, wollte nämlich einen totalitären Staat konstituieren. Viel wahrscheinlicher als Platons Überlieferung ist, dass Sokrates seine Verurteiler wie schon im Prozess provozieren wollte: Er wollte ihnen die billige Ausrede verbauen – nun, man hätte ihn zwar verurteilt, aber immerhin auch die Flucht ermöglicht, also solle man das Ganze doch bitte nicht so ernst nehmen. Nein, sie müssen mit den Konsequenzen ihres Tuns konfrontiert werden und mit ihrem schlechten Gewissen leben, das sie verfolgen wird.
Die sokratische Methode wird meist mit dem Fragen identifiziert. In meiner Lesart ist jedoch ihr Kennzeichen, dass sie die Gegenargumente ernst nimmt und aufhebt: aufhebt in dem Sinne, dass sie sie in die eigene Argumentation integriert, sie erhält, aber ihnen einen anderen Kontext gibt. Diese Methode wurde durch die Scholastik im Mittelalter perfektioniert: Argument und Gegenargument werden gegeneinandergestellt, die Antwort muss beide Seiten enthalten. Dies ist das der Dogmatik entgegengesetzte Verfahren: Die Dogmatik prüft nur, ob eine Aussage mit dem vorab bereits als richtig festgestellten Lehrsatz übereinstimmt oder nicht – stimmt sie überein, geht sie durch, widerspricht sie dem Lehrsatz, muss sie verurteilt werden. Da die Dogmatik den Herrschenden natürlich besser gefällt als die sokratische Methode beziehungsweise die Scholastik, wurde aus dem Prozess gegen Sokrates eine Massenveranstaltung gemacht: die Inquisition.
Doch während die Aufklärung sich damit brüstete, mit dem Aberglauben der Religion ein für alle Mal Schluss gemacht zu haben, hat sie das Verfahren der Inquisition unberührt gelassen. Schon in der Französischen Revolution richtete man massenweise Abweichler vom rechten Glauben genauso hin, wie es die Inquisition getan hatte. Säkulare Herrscher ließen es sich von da an nicht nehmen, inquisitorische Prozesse durchzuführen. Wo kämen wir hin, wenn wir es erlauben würden, dass jeder selber nach der Wahrheit sucht?
So bleibt Sokrates die Provokation der Herrschenden. Es hat sich, was das betrifft, seit damals nicht viel getan. Wer sich heute über die Athener erheben will und darüber lacht, dass sie den ersten und vielleicht größten unter den abendländischen Philosophen in den Tod schickten, der soll sich gefälligst an die eigene Nase fassen und die Frage beantworten: Bist du bereit, infrage stellen zu lassen, was du für die Wahrheit hältst?
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.