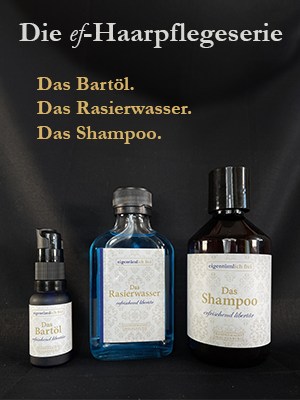Libertäre Philosophie – Teil 3: Platon: Zur Grundlegung des Tugendterrors
Prototyp des Feindes der offenen Gesellschaft
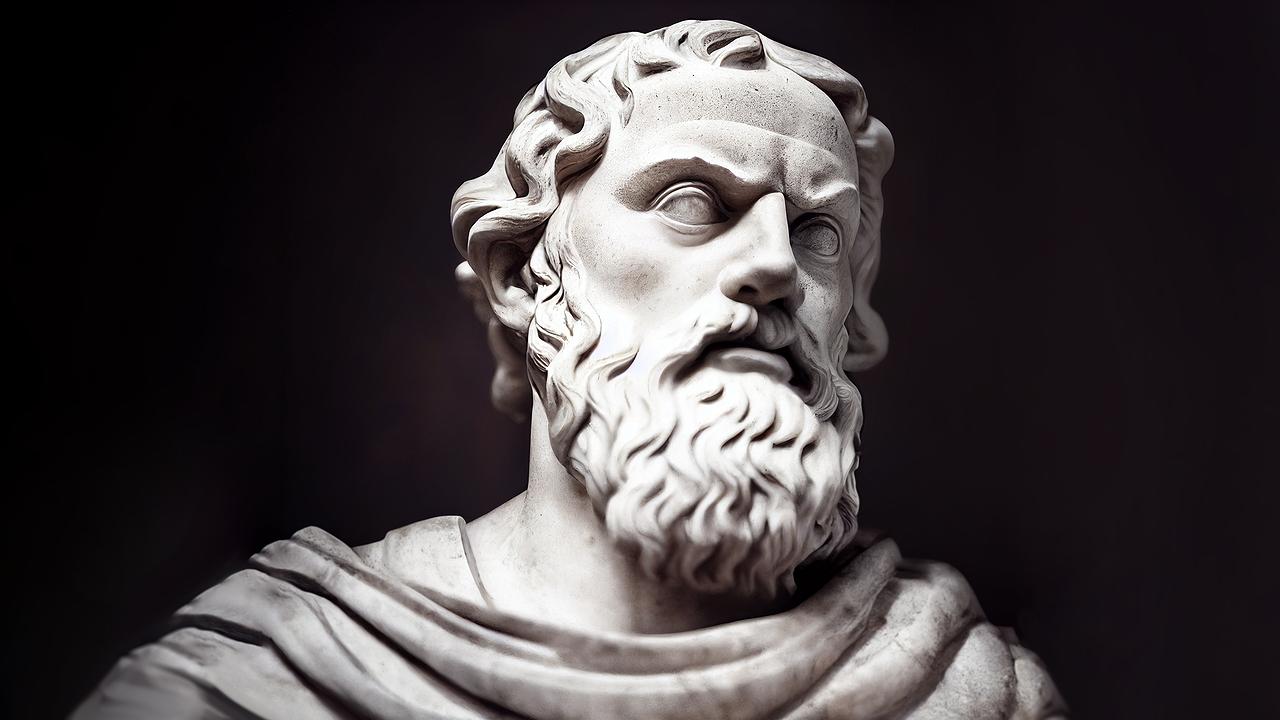
Platon. Athen, 428–347 vor Christus. Zur traurigen Ironie des Weltgeistes (der einen schrägen Humor zu haben scheint) gehört es, dass derjenige, der uns in Gestalt von Sokrates den libertären Ursprung der abendländischen Philosophie überliefert hat, die Philosophie in den Dienst der Herrschaft stellte. Sokrates (Folge 1) hat selber nichts geschrieben. Was wir über ihn wissen, ist vor allem durch Platon überliefert; er hat die sokratischen Dialoge aufgezeichnet, er hat die Rede von Sokrates vor den Richtern dokumentiert.
Welchen Schluss zog Platon aus der Verurteilung seines Lehrers und Vorbilds Sokrates? Offensichtlich taugte die Demokratie nichts. Platon erdachte sich daraufhin einen idealen Staat, der weder vom Mob beherrscht wird wie der, der Sokrates verurteilte, noch von den Griechen wohlbekannten Tyrannen, die weder vernünftig noch klug agierten. Stattdessen müssen die klügsten Menschen regieren, die Philosophen. Aber woher nehmen? Man muss sie erziehen. Von klein auf müssen sie auf ihr Amt vorbereitet werden, nicht durch militärische Spielchen, sondern durch die strenge Disziplin des Denkens und der unbedingten Orientierung an der Wahrheit.
Doch hier schlägt die negative Dialektik unbarmherzig zu. Die Athener verurteilten Sokrates, weil sie der Meinung waren, die Menschen, besonders die jungen Menschen, würden mit unbotmäßigen Fragen nach den Gründen ihres Handelns sofort aus den Latschen kippen (man nennt dies bis heute „Verführung der Jugend“). Genau dieses irre Muster zur Rechtfertigung von Zensur bemühte nun auch Platon. Seine von früh an im Denken gestählten zukünftigen Herrscher der Welt wären sofort und unvermeidlich dazu verführt, in den Abgrund zu fallen, wenn sie auch nur einer Prise Dichtkunst ausgesetzt würden. Denn die Dichter, das sind die berufsmäßigen Lügner, die erklärten Feinde jeder Philosophie. Würden also die Philosophen-Herrscher mit Dichtkunst konfrontiert, könnten sie nicht anders, als zu gefallenen Engeln werden. Ich übertreibe nicht. Das steht so bei Platon. Man könnte über diesen Aberwitz lachen, wenn er nicht so mächtig gewirkt hätte. Jede Religion macht Gebrauch von diesem Muster der Unlogik. Genauso wie der lange im Glauben Geübte abfällt, wenn er das Bild einer nackten Frau sieht, so verginge demjenigen, der von klein auf in der Philosophie ausgebildet wurde, jede Lust an der Wahrheit, wenn er einem Schauspiel beiwohnen würde. Also ist jede Gewalt gerechtfertigt und geboten, um dieser Verführung Einhalt zu gebieten. Im Klartext heißt dies, dass in Platons idealem Staat Sokrates erneut verurteilt werden würde.
Was Platon fehlte, war jede Anbindung an die soziale Wirklichkeit, wie sie im Morgenland Laotse und Zhuangzi (Folge 2) bereits realisiert hatten. Die vernünftigen Herrscher würden, setzte Platon voraus, darum, weil sie vernünftig seien, das Gemeinwesen vorteilhaft leiten können. Dies folgte aus Platons Erkenntnistheorie, die die Ideen vor die Wirklichkeit setzte. Die Wirklichkeit sei ein unmittelbarer Ausfluss der Ideen. Dass wir in der Lage sind, einen Hund zu erkennen, liegt daran, dass er der vorgängigen Idee eines Hundes entspricht, die sich bereits in unserem Kopf befindet. Der reale Hund hat keine Wirklichkeit jenseits dieser Idee, er ist nur ein Abbild dieser Idee, ein Ausfluss dieser Idee, möglicherweise etwas fehlerhaft, aber dennoch hat er kein Sein außerhalb der Idee vom Hund.
Die meisten Menschen, so Platon, können die Ideen, von denen die Wirklichkeit ein Abbild oder Ausfluss sei, aber nicht erkennen. Sie nehmen die Wirklichkeit für die Wirklichkeit. Nur die Philosophen können die Ideen schauen. Darum wird das, was sie tun, immer richtig sein und niemals irgendeine ungewollte Nebenwirkung haben: Sie können sie alle erfassen und haben alles fest im Blick und im Griff. Dies ist der Inhalt seines berühmten Höhlengleichnisses. Da sitzen Menschen in einer Höhle und starren auf die Höhlenwand. Durch den Eingang fällt Licht, das Gegenstände als Schatten dort abbildet. Diese Schatten gelten ihnen als die Wirklichkeit. Aber ein Philosoph verlässt die Höhle und schaut die Wirklichkeit, wie sie ist: In der Sonne zeigen sich ihm die Ideen. Er kehrt in die Höhle zurück und will seine Mitmenschen aufklären darüber, was die Wirklichkeit sei. Aber sie glauben ihm nicht.
Es ist gut möglich, dass Platon hier an Sokrates dachte: Er schaute die Wirklichkeit und wollte seine Mitmenschen aufklären, sie aber glaubten ihm nicht und verurteilten ihn zum Tode, weil er ihre eingefahrenen Vorstellungen infrage stellte. So weit in Ordnung. Doch Platons Schlussfolgerung, dass der Philosoph nun berechtigt sei, seinerseits Gewalt anzuwenden und die Mitmenschen seinen Visionen zu unterwerfen, folgt nicht, jedenfalls nicht zwingend, aus der Geschichte der Verurteilung des Sokrates.
Platons Erkenntnistheorie wird eins der beiden Paradigmata sein, die die Welt des Abendlands in den folgenden Jahrhunderten, ja Jahrtausenden bestimmen. Das andere stammte von Aristoteles (Folge 8). Wir können anhand von Platon auch begreifen, dass die Erkenntnistheorie kein philosophisches Spielchen ist ohne jede praktische Bedeutung. Wir haben es damit zu tun, dass Erkenntnistheorie unmittelbar eine politische Praxis begründet und in Platons Fall zur Rechtfertigung von Herrschaft herhält.
Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass Platons Leugnen von möglichen ungewollten Nebenwirkungen der herrschenden Gewalt bis heute die gängige politische Praxis darstellt. Was auch immer die Staatsgewalt anordnet, die daraus folgenden Nebenwirkungen dürfen ihr nach der herrschenden Lehre nicht zugerechnet werden. Die derzeitigen Hofphilosophen der Herrschenden geißeln überhaupt die Vorstellung von Kausalzusammenhängen als unzulässige Konstruktion. Wenn die herrschenden Philosophen (als die sich die derzeitig Herrschenden oft allzu gern sehen) der richtigen Idee von Gerechtigkeit und ökologischer Korrektheit folgen, können per definitionem ihre Maßnahmen nicht fehlgehen. Eventuell auftretende negative Entwicklungen sind niemals auf ihre Maßnahmen zurückzuführen, sondern immer nur auf den Widerstand von uneinsichtigen Höhlenmenschen. Aber während es diesen nach Platons Meinung immerhin nur an der rechten Einsicht mangelt, werden sie mittlerweile als inhärent bösartig stigmatisiert.
Der Platonismus hat bis zu diesem absoluten Tiefpunkt der Philosophie einige Transformationen durchgemacht, die natürlich Platon nicht als individuelle Schuld zuzurechnen sind. Dennoch ist seine Art des Philosophierens zum Gegenentwurf des sokratischen Skeptizismus geworden, vielleicht nicht ganz in seinem Sinne, doch konsequent aus seinen Schriften abzuleiten. Wer die Reinheit der Idee dem echten und irgendwie auch dreckigen Leben vorzieht, der bereitet dem Tugendterror den Boden: Die Abweichung von der Reinheit der Idee ist das, was dann bekämpft werden muss. Da das Leben zur Abweichung tendiert, heißt dies im Endeffekt, dass man das Leben in seiner Lebendigkeit ablehnt und ihm die Zwangsjacke der politischen Herrschaft anlegt. Hier ist kein Platz für Ausprobieren, für Dialog und Erfahrung, woraus dann neue Wirklichkeiten entstehen, die dem Realitätscheck zu unterziehen sind. Die Offenheit des Ausgangs eines Experiments ist dieser Erkenntnistheorie ein Gräuel und eine Unmöglichkeit.
Mit Platon hat sich die abendländische Philosophie von ihrem libertären Auftrag, den Sokrates ihr gegeben hat, verabschiedet und ist zu einem Instrument der Legitimierung von Herrschaft geworden. Dennoch konnte auch Platon der Philosophie ihren subversiven Charakter nicht vollständig austreiben. Die Herrschaft muss sich auch nach Platon an der Vernunft messen lassen. Sie darf nicht willkürlich vorgehen und nicht Willkürliches behaupten. Das legt der Herrschaft Fesseln an, die sie nicht mag – auch und gerade in ihrer demokratischen Form mag sie das nicht, denn die Mehrheit unterliegt keiner Vernunft. Vernunft ist ein Charakteristikum des Individuums, nicht der anonymen Wählerschaft. Niemand kann behaupten, dass das Abgeben einer anonymen Stimme irgendetwas mit Vernunft zu tun hat. Vielmehr sichert die Anonymität nicht nur gegen Verfolgung, sondern auch gegenüber der Rechtfertigung vor der Vernunft ab: Der Wähler wird geradezu aufgefordert, eine willkürliche, nicht mit Vernunft begründete Entscheidung zu fällen. In diesem Sinne bleibt die Philosophie das, was Sokrates als ihr (im Abendland) konstituierendes Paradigma mitgegeben hat: der Stachel im Fleisch der Herrschenden.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.