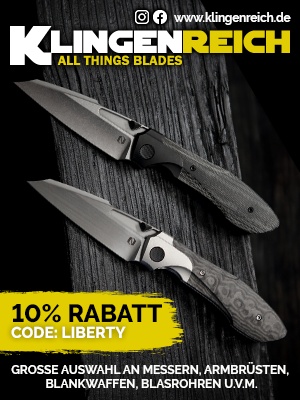Krieg und Frieden – Teil 6: Gerechter Krieg?
Thomas von Aquin

Wollen wir Frieden unter allen Bedingungen? Wollen wir den Status quo der staatlichen Grenzen auch dort widerstandslos akzeptieren, wo sie offenkundig unrecht sind? Wollen wir die inneren Angelegenheiten aller Staaten widerstandslos akzeptieren, auch dort, wo Staaten unfassbare Gräueltaten begehen? Wer diese Fragen mit Nein beantwortet, braucht eine Theorie des gerechten Kriegs, eine Theorie, die besagt, unter welchen Umständen es moralisch erlaubt sei, Krieg zu führen, und auf welche Weise er moralisch gesehen geführt werden dürfe.
Die geschichtlich gesehen wirkungsvollste, inhaltlich gesehen aber wirkungsloseste Theorie des gerechten Kriegs stammt vom heiligen Thomas von Aquin (1224–1274). Er stellte drei Bedingungen für einen gerechten Krieg auf:
Erstens: Er muss vom rechten Herrscher angeordnet sein.
Zweitens: Er muss um die rechte Sache geführt und
Drittens: in der rechten Weise geführt werden.
Die ersten beiden Bedingungen sind weder aufsehenerregend noch kriegsbegrenzend und vor allem alles andere als eindeutig. Wer ist der rechte Herrscher? In seiner politischen Theorie geht Thomas von einer Art Wahlmonarchie aus, deren Vorbild meiner Lektüre nach die Abtwahl im Kloster ist, die einzige politische Struktur, die Thomas wirklich kannte. Gleichzeitig gestand er zu, dass der gewählte Herrscher seinen Charakter ändern und Unrecht tun könne und dass dies sehr häufig geschehe. In diesem Zusammenhang begriff Thomas bereits, dass Macht korrumpiere und absolute Macht absolut korrumpiere: Der Herrscher tendiere zum Unrechttun, weil (oder insofern) ihm kein Widerstand entgegengesetzt werde. Moderne Demokratien kannte Thomas zwar nicht, aber sie stehen nicht besser da. Zudem erhebt sich die Frage, was mit der jeweiligen Minderheit sei. Wie muss sie berücksichtigt werden, wenn es um Krieg und Frieden geht?
Zur zweiten Bedingung. Was ist die rechte Sache? Jede Kriegspartei behauptet, im Recht zu sein. Zwar kann ein Beobachter der einen oder anderen Seite recht geben, dies aber hat keinen Einfluss darauf, ob Krieg geführt wird oder nicht. Wer sich im Recht wähnt und meint, nur durch einen kriegerischen Akt zu seinem Recht kommen zu können, wird die Initiative ergreifen und den Krieg beginnen. Dies tut er nach Abwägung der Chancen im Krieg und der Kosten, die er an Menschenleben und an Sachgütern verursachen wird. Die zweite Bedingung für den gerechten Krieg ist bei genauer Betrachtung überhaupt keine Bedingung. Sie ist immer erfüllt, jedenfalls soweit es die subjektive Abwägung der kriegführenden Parteien betrifft.
Dagegen hat es die dritte Bedingung in sich, jedenfalls in der Form, in der Thomas sie kleidete: Die rechte Art, Krieg zu führen, bedeute, dass Unschuldige und Unbeteiligte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Thomas ging von dem in Friedenszeiten gültigen Begriff der Gerechtigkeit oder der Moral aus, dass niemand Unschuldiges und Unbeteiligtes einer Strafe zu unterwerfen sei, und verneint radikal die utilitaristische Relativierung, dass um der guten Sache willen Kollateralschäden hingenommen werden müssten oder auch nur dürften. Jemanden für etwas zu bestrafen oder zur Rechenschaft zu ziehen, das er nicht begangen hat, ist Unrecht. Immer und überall. Der Krieg setzt laut Thomas diesen moralischen Grundsatz der Gerechtigkeit nicht außer Kraft. Thomas’ dritte Bedingung trifft allenfalls für Ritterheere zu, die sich auf offenem (unbewohntem) Feld treffen und die Waffen kreuzen: Jeder der Beteiligten steht unter seinem rechtmäßigen Heerführer und jeder hat eingewilligt, Teil seines Heer zu sein. Alle sind beteiligt und alle sind schuldig. Sofern das siegreiche Heer nicht über die Bevölkerung herfällt, die das besiegte Heer zu schützen trachtete, ist Thomas’ Bedingung erfüllt.
Für Thomas unterscheidet sich ein Krieg nicht von irgendeiner sonstigen polizeilichen Maßnahme. Damit ist auch die in Teil 3 der Serie angesprochene merkwürdige moderne Unmoral ausgeschlossen, derzufolge zwar das Fußvolk des Gegners massenweise getötet werden darf, während eine gezielte Tötung der gegnerischen militärischen oder politischen Führung als „Mord“ eingestuft wird. Laut Thomas ist es gerade eine gezielte Tötung der jeweiligen Übeltäter, die der Gerechtigkeit am meisten entspricht. Jede Form der modernen Kriegsführung ist mit Thomas’ dritter Bedingung ausgeschlossen.
Die dritte Bedingung von Thomas für einen gerechten Krieg besagt auch, dass jede kriegführende Partei es vorziehen muss, zu unterliegen, statt Gräuel zu begehen. Damit steht Thomas’ Theorie des gerechten Kriegs diametral gegen die ebenfalls in Teil 3 besprochene Aussage Carl von Clausewitz’, der Krieg müsse zur Eskalation der Gewalt führen, weil eine unausgeschöpfte Möglichkeit der Kriegsführung das Unterliegen nach sich ziehe. Mit Thomas wäre zu fragen, woher der Imperativ stamme, in jedem Fall siegen zu müssen. Aber wer ist tatsächlich bereit, um eines moralischen Prinzips willen auf den Sieg zu verzichten?
Die russisch-amerikanische Thomistin Ayn Rand (1905–1982) machte es sich einfach, Thomas’ Bedingungen des gerechten Kriegs zu umgehen. Der rechte Herrscher sei der demokratisch gewählte (erste Bedingung) und die rechte Sache der Krieg gegen Diktatur (zweite Bedingung). Die Möglichkeit, dass demokratische Staaten Krieg gegeneinander führen, betrachtete sie nicht; sie war für sie undenkbar. So weit, so klar (wenn auch naiv). Aber was ist mit der dritten Bedingung, dass der Krieg auch in der rechten Weise geführt werden müsse? Ayn Rand erklärte kurzerhand alle Bewohner der gegnerischen Diktatur zu Schuldigen. Jeder mache sich zumindest dadurch schuldig, dass er es nicht vermochte, die Diktatur zu besiegen. Damit wird Erfolglosigkeit zu einem ethischen Makel: Auch derjenige, der die Diktatur ablehnt oder sogar aktiv bekämpft, ist „schuldig“ allein dadurch, dass er keinen Erfolg mit seiner Opposition hat. Dies ist übrigens eine Gedankenfigur, auf die diejenigen Feinde Israels rekurrieren, wenn sie jeden Israeli (manche darüber hinaus sogar jeden Juden) zum Abschuss freigeben (mehr dazu im Teil 11 der Serie). Ich möchte Ayn Rand nicht unterstellen, willentlich Ideengeberin von Terroristen zu sein. Die Koinzidenz jedoch ist bemerkenswert.
Das Argument gegen Ayn Rand spitze ich mit der fragwürdigen rhetorischen Figur ad hominem zu: In der Zeit des Vietnamkriegs (siehe Teil 9 der Serie) hätte jeder Vietcong Ayn Rand als Akt im gerechten Krieg töten können, da sie unfähig war, ihre demokratisch gewählte Regierung daran zu hindern, ihn zu führen. Zwar könnte man sagen, die militärischen Aktionen der USA stellten den Krieg der demokratischen USA gegen den undemokratischen Vietcong dar (rechte Sache, das heißt, zweite Bedingung erfüllt); aber dies war ausdrücklich nicht die Auffassung von Ayn Rand. Sie lehnte den Vietnamkrieg ihrer Regierung ab.
Unter der Hand müssen wir die Frage, ob es erlaubt und erwünscht sei, für die rechte Sache, etwa die Menschenrechte, einen Krieg zu führen, noch ergänzen durch die Frage, welche Kosten an Menschenleben und an materiellen Gütern man dafür hinzunehmen bereit ist. Dies ist aber ein utilitaristisches, moralisch fragwürdiges Kriterium. Überdies lässt es sich erst ex post evaluieren, was das Kriterium moralisch nahezu wertlos macht; jedenfalls eignet es sich nicht dazu, eine rationale oder ethische Entscheidung zu treffen, weil wir dazu ein Ex-ante-Kriterium benötigen. 1978 beendete das gerade erst kommunistisch wiedervereinigte Vietnam völkerrechtswidrig die Schreckensherrschaft der kommunistischen Roten Khmer in Kambodscha. Obwohl es noch einige Zeit einen unter anderem durch die USA unterstützten Widerstand gegen die vietnamesische Okkupation in Kambodscha gab, lief sie insgesamt relativ glimpflich ab. Dies war nicht vorherzusehen; die Prognosen standen damals schon allein darum ziemlich schlecht, weil zwischen Kambodscha und Vietnam eine Art Erbfeindschaft bestand.
Da kaum jemand einen Krieg beginnt, der ihm bereits im Anfang als aussichtslos erscheint, lässt sich das utilitaristische Kalkül niemals ausschließen; ja, realistisch besehen, nimmt es sogar eine zentrale Stellung ein und rangiert noch vor der Frage der rechten Sache: Einen Krieg um einer gerechten Sache willen anzuzetteln, der nicht zu gewinnen ist, wäre eine unmoralische Vergeudung von Menschenleben und materiellen Gütern, selbst wenn es um die Befreiung von Menschen aus schwerster Unterdrückung geht. Niemand hat ernsthaft erwogen, die Volksrepublik China zu okkupieren, als dort aufgrund einer Reihe von Fehlentscheidungen, die unter Mao Zedong getroffen wurden, Millionen Menschen verhungerten. Unter dem Kriterium, das Vietnam das Recht gab, Kambodscha zu okkupieren, wäre auch eine solche Okkupation Chinas geboten gewesen; aber sie war nicht machbar. Machbarkeit ist offensichtlich kein moralisches Kriterium.
Das Nachdenken über Krieg und Frieden zeigt, dass die einfachen Antworten nicht greifen. Krieg ist immer ein Desaster und bringt Leid über die Menschen. Aber ein Akzeptieren des Status quo, um Frieden zu halten, kann ebenfalls Leiden bringen. Für den gerechten Krieg haben wir kein belastbares Kriterium. Und die Entscheidung, ob ein Krieg geführt wird, kommt ohne ein utilitaristisches, nicht-moralisches Kalkül nicht aus. Um einen Krieg zu führen, bedarf es der Koalitionen mit Kräften, die den ursprünglichen moralischen Kriterien nicht genügen – und damit kippt er in die Fortsetzung eines Unrechts.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.