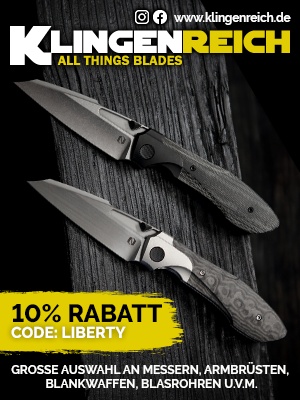Fass ohne Boden: Der Fetisch der Begegnung
Wie sich Stadtplaner den optimalen Menschen erträumen
von David Andres drucken

Stadtmöbel und gesprengte Utopien zwischen Wuppertal und Duisburg.
Dieser Tage geht in Wuppertal mal wieder ein Experiment zuende, bei dem man einige der verhassten Parkplätze gegen Pflanzkübel, Fahrradabstellplätze und vor allem große Stadtmöbel tauschte. Die Idee: „Neue Impulse für die Nutzung des öffentlichen Raums setzen.“ Ausführlicher formuliert: „Ziel ist es, den Straßenraum als multifunktionale Fläche erlebbar zu machen und dessen Potenzial über die reine Nutzung als Verkehrsfläche hinaus aufzuzeigen. Die temporären Umgestaltungen sollen Nachbarschaften fördern, Raum für Begegnungen schaffen und Aktivitäten von Anwohnenden, Initiativen oder Kulturschaffenden ermöglichen.“
Es ist faszinierend. Seit den Sechzigerjahren träumen Sozialplaner, Architekten und Gesellschaftsingenieure davon, in Großstädten eine Art dörfliche Gemeinschaft erzeugen zu können, die – Sie ahnen es bereits – nachweislich nur in Dörfern und kleinen Gemeinden funktioniert. Die Stadtmöbel von Wuppertal haben insofern ideologisch durchaus mit dem großen Knall zu tun, der dieser Tage in Duisburg zu erleben war, im Stadtviertel Hochheide, einem bundesweit bekannten Brennpunkt. Dort hat man einen weiteren der sogenannten weißen Riesen gesprengt – ein Hochhaus aus einem Ensemble von sechs Hochhäusern, die im Zeitraum ihrer Errichtung als Stadtmodell der Zukunft galten. Von 1969 bis 1974 zog die Stadt diese Gebäude hoch und Sie müssen sich diese Epoche vergegenwärtigen. Getrieben von einer Mischung aus sozialistischer Utopie und der Kindlichkeit der Hippiebewegung, gingen die „progressiven“ Planer damals davon aus, man könne mit Häusern, die teils 320 und teils 160 Einheiten beinhalteten, eine Art vertikale Gemeinschaft erzeugen, die sich nicht nur auf den Fluren prächtig versteht, sondern vor allem auf den Grünflächen dazwischen trifft und die „Begegnung“ auslebt, die man sich heute immer noch von Stadtmöbeln zwischen Pflanzkübeln erhofft.
Das Ergebnis nach wenigen Jahrzehnten war in Duisburg eines der schlimmsten Ghettos des Bundeslandes; berühmt dafür, dass Paketboten es nicht mehr anfuhren, geprägt nicht von fröhlicher Begegnung zu Fuße der Türme, sondern von – wie der WDR schreibt: „Kakerlaken, Tauben und Müll.“ Fünf der insgesamt sechs weißen Riesen sind mittlerweile vernichtet. Der sechste, der noch steht, gilt allerdings von den Bewohnern her als schlimmster. Womöglich traut man sich an ihn nicht ran und fürchtet die tatsächliche „Begegnung“, die dort stattfindet.
Projekte mit Verkehrsberuhigung und dem Umbau der Innenstädte gibt es weiterhin überall. Besonders begeistert ist die Redaktion der Webseite „Transformation Wuppertal“ vom Vorbild Barcelona. Dort habe man schon 2016 den ersten sogenannten Superblock angelegt, also neun Straßenblöcke zu einem Gebiet fusioniert, in dem motorisierter Verkehr fast komplett verboten ist. Hier hört der von Freiheitsfunken angezündete Mensch die Nachtigall mit Kampfstiefeln trapsen, denn er denkt an das im Rahmen der „Agenda 2030“ in zahllosen Metropolen geplante Konzept der „15-Minuten-Städte“, das eine eigene Reportage erfordert, aber den Gipfel darin darstellt, die alten Utopien wieder neu aufleben zu lassen – quasi auf Steroiden. Kombiniert mit den Möglichkeiten der digitalen Überwachung und kluger KI-Algorithmen, möchte man uns dort ja zur „Begegnung“ auf kleinstem Raum zwingen, die Stadt in Viertelchen zerclustern, die Bewegungsfreiheit einschränken.
In Wuppertal hat man das Experiment des neuen Stadtbildes im Quartier Ölberg immerhin mit ausführlicher Befragung der Bevölkerung begleitet. Im Ergebnis sollen die Menschen der Projektleitung vor allem ihr Herz über „konkrete Alltagssorgen“ ausgeschüttet haben, „wie lang parkende Gewerbefahrzeuge“ oder den „hohen Stellplatzbedarf einzelner Haushalte“.
Mit anderen Worten: sie gehen nicht auf die Utopie ein. How dare they?
In Vohwinkel, einem anderen Viertel Wuppertals, hat die Stadt „fünf Parkplätze an der Kaiserstraße“ für die nächsten Jahre dauerhaft durch moderne Sitzgruppen ersetzt. Stünden die rund geschwungenen Bänke in einem Park oder einem Open-Air-Kunstmuseum, lüden sie tatsächlich zum Verweilen ein. So sehen die meisten Befragten in einem Beitrag des Regionalfernsehens darin nur das „Fass ohne Boden“ von Geldverschwendung und Platzbegrenzung – und eine Mutter macht darauf aufmerksam, dass ihr Kind aus dieser gemütlichen Sitzgruppe heraus, mangels Begrenzung zur Straße, frohgemut zwischen die Autos springt. Aber was ist schon der ein oder andere Kollateralschaden, wenn eine gesellschaftliche Utopie durchgesetzt werden soll?
Quellen:
Neue Stadtmöbel am Ölberg: Parkplätze werden zu Begegnungszonen (Wuppertal-total)
Hochhaus „Weißer Riese“ in Duisburg ist gesprengt (WDR)
Gute Beispiele für Mobilität (Transformation Wuppertal)
Haben wa' sowas in Vohwinkel gebraucht? (Talzeit Wuppertal)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.