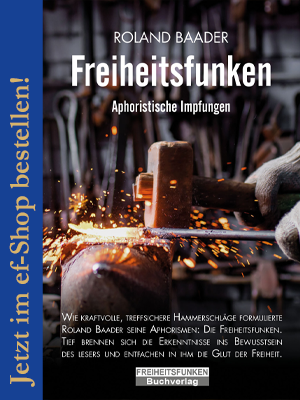EU-USA-Handelsabkommen: Europa am Katzentisch
Trumps Zoll-Deal zeigt, wie schwach die EU wirklich ist
von Joana Cotar drucken
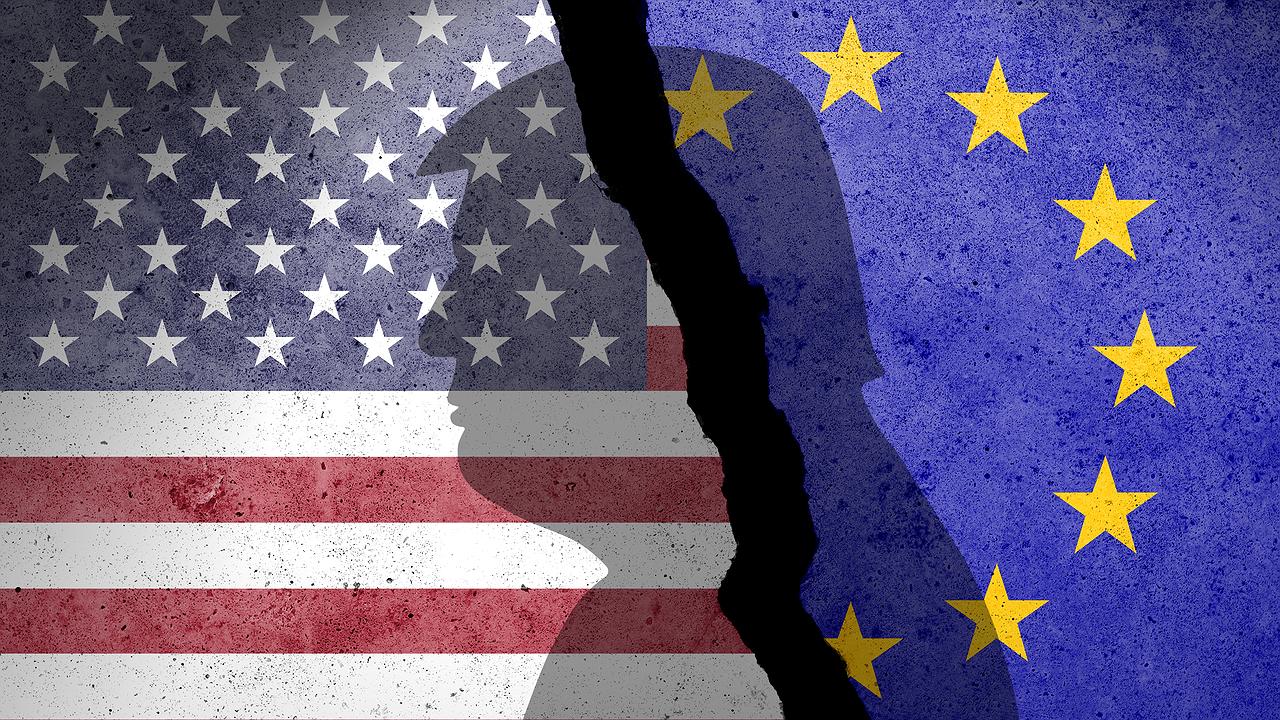
Donald Trump ist zurück und mit ihm der raue Wind eines Handelsnationalismus, der Europa eiskalt ins Gesicht weht. Sein jüngster Zoll-Deal mit der EU, von amerikanischen Medien als „Triumph der Verhandlungskunst“ bejubelt, ist weit mehr als ein kluger Deal. Er ist ein Schlag ins Gesicht für eine Europäische Union, die ihre Schwächen längst nicht mehr verbergen kann. Warum konnte Trump so leicht punkten? Weil er wusste, wo er zupacken muss, und weil die EU ein Sanierungsfall ist, wirtschaftlich wie strategisch.
Trump hat den Deal nicht aus dem Bauch heraus gemacht, er spielte seine Karten aus einer Position der wirtschaftlichen Überlegenheit. Die USA verfügen über eine starke, wettbewerbsfähige Wirtschaft, und Trump versteht es meisterhaft, diesen Vorteil als Druckmittel einzusetzen. In einer Welt, in der Macht nicht nur in Panzern, sondern auch mit Patenten und Plattformen gemessen wird, steht Europa zu oft auf der Zuschauertribüne.
In Brüssel debattiert man über Lieferkettengesetze, CO₂-Grenzwerte und digitale Ethikrichtlinien. In Washington investiert man in künstliche Intelligenz, Mikrochipproduktion und militärische Schlagkraft. Der Unterschied ist fundamental. Europa hat sich im Glauben an moralische Vorbildlichkeit eingerichtet, doch moralische Prinzipien ersetzen keine strategische Handlungsfähigkeit. Innovation lässt sich nicht anordnen und globale Machtpositionen nicht herbeiregulieren.
Wer in der wirtschaftlichen Offensive sein will, muss Geschwindigkeit, Risikobereitschaft und institutionelle Klarheit mitbringen. Europa hingegen betreibt einen regulatorischen Hochseilgarten, in dem selbst Start-ups jahrelang um Genehmigungen ringen. Kein Wunder, dass die digitalstrategische Aufholjagd gegenüber den USA und China zur Dauerübung ohne Fortschritt geworden ist.
Militärisch schwach: Die sicherheitspolitische Achillesferse Europas
Doch die größte Schwäche Europas liegt nicht einmal im wirtschaftlichen Rückstand. Sie liegt in seiner sicherheitspolitischen Abhängigkeit, und genau hier setzte Trump an. Die EU profitiert seit Jahrzehnten von der militärischen Schutzgarantie der USA, ohne die entsprechenden Lasten zu schultern. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der Unruhe im Nahen Osten und der zunehmenden Spannungen im Indopazifik wird diese strategische Abhängigkeit zur Achillesferse.
Trump wusste und weiß, dass die EU sich keine Konfrontation leisten kann. Wer beim Schutz des eigenen Landes auf andere angewiesen ist, kann an den Verhandlungstisch nur mit gesenktem Blick treten. In der Sprache der Geopolitik bedeutet das: Wer keine eigene Macht projizieren kann, wird zum Objekt fremder Interessen.
EU auf der Kippe
Die Länder der Europäischen Union stehen damit an einem Scheideweg. Wollen sie ein ernstzunehmender Akteur bleiben, braucht es mehr als kosmetische Korrekturen. Sie müssen wirtschaftliche Dynamik freisetzen, technologische Souveränität aufbauen und sicherheitspolitisch erwachsen werden. Das bedeutet: Investitionen in Verteidigung, eine Stärkung nationaler Resilienz-Strukturen und – vor allem – ein wirtschaftsliberaler Neustart. Europa muss seinen Glauben an eine dirigistische Steuerungspolitik überwinden. Weniger Steuern, mehr Freiheit. Weniger Vorschriften, mehr Vertrauen in Unternehmertum. Weniger Bürokratie, mehr Wettbewerb. Nur so kann der Kontinent zu einer Zone echter Wertschöpfung, echter Innovation und echter strategischer Autonomie werden.
Die EU kann den
Teufelskreis, in dem sie steckt, durchbrechen, aber dafür muss sie sich
grundlegend erneuern. Mehr Freiheit und weniger Bevormundung bedeutet auch mehr
Glaube an das Subsidiaritätsprinzip und an eine EU, wie sie einst war: eine
europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kein bürokratischer Moloch, das alles an
sich zieht.
Jetzt oder nie
Der Zoll-Deal mit Trump ist mehr als ein schlechter Vertrag: Er ist ein Alarmsignal. Er zeigt, wie leicht wir unter Druck geraten, wenn wir wirtschaftlich träge und militärisch abhängig sind.
Doch genau darin liegt auch eine Chance. Wenn wir diesen Moment ernst nehmen, können wir den Kurs ändern. Doch dafür braucht es Mut und einen festen Willen: für wirtschaftliche Freiheit, für digitale Offenheit und für sicherheitspolitische Eigenständigkeit. Es braucht den Willen und die Kraft, den Reformstau aufzulösen, und Mut, um sich in der europäischen Zusammenarbeit auf das Wesentliche zu konzentrieren und allen anderen Ballast abzuwerfen.
Wenn wir die richtigen Lehren aus dieser Krise ziehen, können wir gestärkt aus ihr hervorgehen und wieder zu einem echten Gegenüber der USA werden. Nicht als Juniorpartner, sondern als selbstbewusster Akteur auf Augenhöhe. Denn eines ist sicher: Die nächste Runde mit einem US-Präsidenten kommt bestimmt und diesmal sollten wir vorbereitet sein.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.