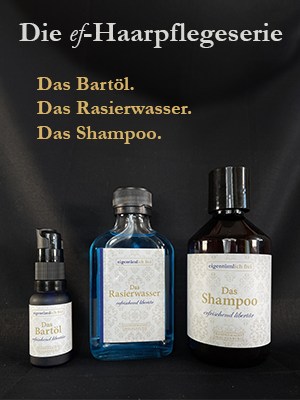Sexualität und Freiheit – Teil 4: Wie nötig sind Schranken der Sexualität?
Ludwig von Mises und Sigmund Freud

Sigmund Freud habe erkannt, dass es enger Schranken für die Sexualität bedürfe, um eine Gesellschaft möglich zu machen, bemerkte Ludwig von Mises mit Genugtuung in seinem Spätwerk „Theory and History“ (1957). Dass sich Mises wohlwollend auf Sigmund Freud bezog, mag verwundern. Ludwig von Mises ist als Ökonom bekannt, weniger als jemand, der allgemeine soziologische und psychologische Theorien entwickelte. Zudem fiel die durch ihn formulierte Verteidigung liberaler Wirtschaftsprinzipien eher bei den kulturkonservativen Kreisen auf fruchtbaren Boden, die in Freud den Propagandisten ungezügelter Sexualität und den Zerstörer der Familie sehen.
Ludwig von Mises hat recht: Freud war dezidiert kein Propagandist ungezügelter Sexualität, in keiner Hinsicht, und es lag zumindest nicht in seiner Absicht, die Familie zu zerstören. Sexualität als Bedürfnis hat laut Freud die Tendenz, die geordneten gesellschaftlichen Abläufe zu stören. Sie müsse zeitlich und räumlich beschränkt und strikten Regeln des Erlaubten unterworfen werden. Allerdings machte Freud darauf aufmerksam, dass diese Beschränkung der Sexualität zu einem „Unbehagen in der Kultur“ führe, das sich zerstörerisch gegen die Kultur richte. Damit landete er bei einem Paradox, aus dem er nach eigenem Bekunden keinen Ausweg fand: Beschränkung der Sexualität ist notwendig, um Gesellschaft zu ermöglichen, zugleich aber hat sie die Tendenz, die Gesellschaft zu zerstören.
Von diesem Paradox lesen wir bei Ludwig von Mises nichts. Beschränkung der Sexualität ist notwendig. Basta. Auch lesen wir nichts zu der Frage, wie denn diese Beschränkung durchzusetzen sei. Zwei grundsätzliche Wege stehen offen: Der eine Weg ist der über die öffentliche Moral oder Sittlichkeit, der andere der über gesetzlichen Zwang. Der Weg über die öffentliche Moral oder Sittlichkeit ist einerseits erfolgreich, weil (fast) jeder Mensch abhängig ist von der Anerkennung oder Ächtung durch seine unmittelbare Umgebung. Andererseits ist dieser kaum steuerbar. Die öffentliche Moral oder Sittlichkeit entwickelt sich, wie sie sich eben entwickelt, und zwar im Sinne von Friedrich August von Hayeks „spontaner Ordnung“. Es mag sein, dass die öffentliche Moral und Sittlichkeit eher freizügig oder dass sie eher restriktiv der Sexualität gegenüber ist. Wenn jemand die Meinung vertritt, dass das, was gerade der öffentlichen Moral und Sittlichkeit entspricht, korrigiert werden müsse, kann er dies nur über gesetzlichen Zwang erreichen. Solche Strategien sehen wir auf der konservativen („rechten“) Seite, wenn sie Sittenstrenge wiederherstellen wollen; besonders krass war dies nach der Islamischen Revolution im Iran zu beobachten, seitdem die sogenannten Revolutionsgarden wüten. Aber auch auf der progressiven („linken“) Seite werden solche Strategien eingesetzt, etwa wenn es gegen gesellschaftlich akzeptierte Formen der Diskriminierung geht.
In dem Fall, dass die öffentliche Moral und Sittlichkeit mit der Ansicht Ludwig von Mises’ (und Sigmund Freuds) übereinstimmen, dass sie der Beschränkung der Sexualität bedürfe, ergibt sich kein Problem, aber auch keine Notwendigkeit, darauf hinzuweisen, denn die Beschränkung wird ja durch die spontane Ordnung aufrechterhalten. Der Hinweis macht überhaupt nur dann Sinn, falls die öffentliche Moral und Sittlichkeit gerade umgekehrt eine größere Freizügigkeit gestatten, der gegenüber man anmahnt, die Beschränkung sei unverzichtbar. Obgleich das Erscheinungsdatum von „Theory and History“ mit 1957 nicht in der Hochzeit der sexuellen Revolution liegt, so kann man doch sagen, dass der Wandel in der öffentlichen Moral und Sittlichkeit sich bereits bemerkbar machte und Ludwig von Mises darauf reagierte. Hat er somit ein repressives Vorgehen des Staatsapparats und seiner Justiz befürwortet? Handlungslogisch gesehen wäre ihm nichts anderes übrig geblieben. Hierüber hat er sich ausgeschwiegen, weil die handlungslogische Konsequenz gegen seine eigene Theorie der Handlungslogik verstößt, wie ich jetzt zeigen werde.
Die Ökonomik des Ludwig von Mises’ ist weit mehr als eine ökonomische Theorie, sie ist eine voll entfaltete Handlungslogik. Diese geht davon aus, dass jede Handlung ein Ziel verfolge. Das Ziel strebt man auf dem schnellstmöglichen Weg mit dem geringstmöglichen Aufwand an. Gegen dieses ökonomische Kalkül werden allerlei Einwände vorgebracht, die allesamt nicht stichhaltig sind oder auf einer fehlerhaften Formulierung des Kalküls basieren. Wer beispielsweise auf dem Weg zu einem Treffen einen Umweg geht, um auf der Strecke eine schönere Aussicht zu haben, macht dies, weil er neben dem Ziel, zum Ort des Treffens zu gelangen, ein zweites Ziel verfolgt, nämlich das der schönen Aussicht. Die genaue Formulierung des ökonomischen Kalküls erfordert nach Ludwig von Mises sowohl die Einbeziehung von möglichen Subzielen als auch diejenige von immateriellen psychischen Zielen. Treten auf dem Weg zu dem Ziel Hindernisse auf, versucht der Handelnde nach bestem Können, diese zu überwinden, und zwar ebenso mit dem ökonomischen Kalkül des kürzesten Wegs und dem geringsten Aufwand (beides unter Einbeziehung der immateriellen psychischen Faktoren). Diese Umgehungstendenz gegenüber Hindernissen – seien es natürliche, soziale oder gesetzliche Hindernisse – ist unvermeidbar; sie wurde durch Ludwig von Mises in der Ökonomik und durch Kurt Lewin in der Psychologie entdeckt.
So weit zu dem, was den einzelnen Handelnden betrifft. Wenden wir uns nun dem sozialen Zusammenspiel der Handelnden zu. Sofern jeder Handelnde frei ist, über seine Handlungen zu entscheiden, ergibt sich das Optimum für alle Beteiligten: Jeder verfolgt allein oder in freiwilliger Kooperation seine Ziele, die er auf die unter den gegebenen Umständen optimale Weise realisiert. Die einzige Möglichkeit, ein besseres Ergebnis zu erzielen, ergibt sich für einen Handelnden, wenn er auf andere Handelnde Zwang ausübt, entweder indem er direkten (kriminellen) Zwang begeht oder indem er indirekt durch die Beeinflussung der Gesetzgebung staatlichen Zwang in Anspruch nimmt. Für die anderen Handelnden stellt dieser Zwang ein Hindernis dar, das sie auf die ihnen mögliche Weise zu umgehen trachten, um ihre eigenen Ziele dennoch verwirklichen zu können. Diese, gegenüber der natürlichen (spontanen) Ordnung, künstlichen Hindernisse erhöhen die Handlungskosten, senken also den Wohlstand aller. Sie führen zu sozialem Ungleichgewicht und zu rebellischem Unmut – sie sind der Motor zum kulturzerstörerischen „Unbehagen in der Kultur“, wie Freud es formulierte.
Nach den vorangegangenen Überlegungen sehe ich keinen Grund, der Sexualität im Rahmen der Handlungslogik, wie Ludwig von Mises sie formulierte, einen Sonderstatus einzuräumen. Es bedarf keiner speziell auf die Sexualität zugeschnittenen Schranken. Freiwilligkeit als gesellschaftliches Prinzip der menschlichen Interaktionen reicht völlig aus. Sofern alle Beteiligten freiwillig interagieren, gibt es keinen ökonomischen, soziologischen, psychologischen und moralischen Grund, über das von der öffentlichen Moral und Sittlichkeit hinausgehende und unverfügbare Maß einzugreifen.
Mehr noch: Falls die gesetzgeberische Maschine in diesen Intimbereich eingreift, wird sie eine soziale Unordnung hervorrufen und Perversionen heranzüchten. Die handlungslogische Theorie des Ludwig von Mises beweist uns dies. Die Empirie über die Jahrtausende der menschlichen Geschichte bestätigt es.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.