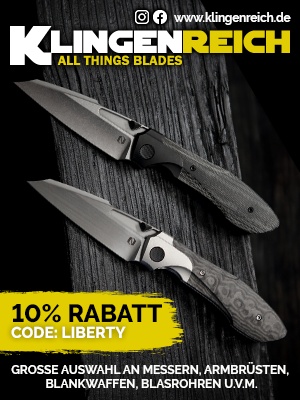Zur Lage in Deutschland: Woher kommen die Probleme und wie kann ihnen abgeholfen werden?
Staatsabbau als Lösung

In der zunehmenden Politisierung aller Lebensbereiche liegt der Kern der Probleme, mit denen Deutschland derzeit zu ringen hat. In der stagnierenden Produktivität zeigen sich diese Übel statistisch.
Deutschland ist ein Schlüsselstaat Europas – ökonomisch, politisch und kulturell. Von seiner Stabilität hängt weit mehr ab als nur die nationale Wohlstandsfrage: Deutschlands Kurs beeinflusst die Zukunft der Europäischen Union und den Zustand der westlichen Zivilisation insgesamt. Doch der Blick von außen offenbart, dass die einstige Vorbildfunktion des Landes zunehmend erodiert.
Noch ist Wohlstand sichtbar, doch er ist nicht das Resultat kluger Politik, sondern besteht trotz der Politik. Die ökonomischen und sozialen Strukturen, die heute noch tragen, sind das Erbe der Nachkriegszeit, jener ersten Jahrzehnte, in denen Leistung, Bildung und Eigenverantwortung noch als Tugenden galten. In den letzten Jahrzehnten jedoch sind kaum neue produktive Impulse hinzugekommen. Der gegenwärtige Reichtum zehrt vom Erbe vergangener Generationen – ein Kapital, das aufgebraucht wird. Die Kräfte des Niedergangs haben inzwischen die Oberhand gewonnen.
Politik ist die Ursache, sie ist nicht die Lösung der Krise. Deutschland leidet an einem Teufelskreis schlechter Politik. Auf jede politische Fehlentscheidung folgt eine neue Intervention, die weitere Schäden verursacht und wiederum als Begründung für noch mehr Staatseingriffe dient.
Anstatt den Marktmechanismus wirken zu lassen, wird immer lauter nach dem Staat gerufen, nach neuen Regulierungen, Subventionen und Umverteilung. Doch jeder dieser Eingriffe wirft Sand ins Getriebe von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Markt, dieser feinsinnige Mechanismus freiwilliger Kooperation, beginnt zu stottern. Produktionsstrukturen verzerren sich, Innovationskraft erlahmt, Fehlanreize häufen sich.
Der Staat hat eine legitime Funktion nur insoweit, als er die freiwillige Zusammenarbeit der Menschen erleichtert – also die gesellschaftliche Arbeitsteilung fördert. Sobald jedoch die Staatstätigkeit diese Kooperation behindert, etwa durch übermäßige Besteuerung, Reglementierung oder Bevormundung, verliert sie ihre Legitimation. Noch gravierender wird die Lage, wenn die politische Führung ihre Macht auf zerstörerische Ziele richtet: auf Krieg, auf soziale Spaltung oder auf wirtschaftliche Selbstzerstörung. Ein solcher Staat verliert sein moralisches Fundament. Aus Gründen der Vernunft – nicht aus Emotion oder Ideologie – ergibt sich dann eine Pflicht zum Widerstand: friedlich, argumentativ, aber entschlossen.
Die ökonomischen Daten sprechen eine deutliche Sprache: Produktivitätszuwächse stagnieren, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit schwinden. Das Wirtschaftswachstum bleibt schwach, trotz massiver fiskalischer Impulse. Die Staatsquote steigt kontinuierlich – inzwischen beansprucht der Staat über die Hälfte des nationalen Einkommens.
Ein Indikator, der wie nur wenige andere Kennziffern für die Lage eines Landes ein aussagefähiges Bild abgibt, ist die Produktivitätsentwicklung. In dieser Kennziffer zeigen sich die Stärken und Schwächen eines Landes. Für Deutschland kristallisieren sich in der Trendwende dieses Maßstabs die Übel, die das Land in den letzten Dekaden erfasst haben. In den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Produktivität stetig angestiegen und hat Deutschland zu einem der produktivsten Länder gemacht. Die Wirtschaftsleistung pro Erwerbstätigen hat lediglich im Zuge der Wiedervereinigung eine leichte Delle erlitten, ist aber in dem Jahrzehnt danach noch schneller gestiegen als in der Zeit davor. Ein Bruch dieses jahrzehntelangen Trends erfolgte zuerst 2008. Von diesem Einbruch, der von der globalen Finanzkrise ausging, zu dem 2010 die europäische Schuldenkrise dazukam, hatte sich allerdings die Produktivität bis 2011 schon wieder voll erholt. Seitdem jedoch stagniert die Wirtschaftsleistung pro Erwerbstätigen und sie ist seit 2020 sogar rückläufig. Beim Indikator der Totalen Faktorproduktivität (TFP), der über die Arbeit hinausgehende Produktionsfaktoren, vor allem auch Kapital einbezieht, verzeichnet Deutschland bereits seit den 1990er Jahren eine sich verlangsamende Steigerung. In den 1990er Jahren betrug die Trendwachstumsrate der TFP noch merklich über ein Prozent pro Jahr. Nach der Jahrtausendwende ist diese Rate immer weiter abgesunken, und in den vergangenen zehn Jahren hat sich diese Tendenz noch beschleunigt.
Diese Entwicklung spiegelt nicht nur die tieferen Probleme des Landes wider, die Produktivität gibt auch die Grenze an, innerhalb derer der zukünftige Wohlstand wachsen kann. Hier sprechen die Zahlen für sich. Angesichts dieser langen Stagnation und dem abwärts gerichteten Trend der letzten Jahre sind weder Reallohnzuwächse noch sonstige Wohlstandsgewinne mehr möglich. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und die Aussage treffen, dass auf Deutschland, wenn der Abwärtstrend noch weiter anhält, scharfe Einbrüche beim Wohlstand zukommen werden.
Diese Entwicklung führt Deutschland zurück in eine Situation, die man schon überwunden glaubte: Stagflation – das gleichzeitige Auftreten von Inflation und Wachstumsschwäche. Die Ursachen liegen nicht in einem Markt-, sondern in einem Politikversagen.
Parallel zur ökonomischen Schwäche vollzieht sich eine gesellschaftliche Fragmentierung. Die Einkommens- und Vermögensdisparität nimmt zu, nicht primär als Folge des Kapitalismus, sondern wegen der politisch geschaffenen Privilegienordnung. Wer Zugang zu Subventionen, Regulierungsvorteilen oder Bürokratieposten hat, profitiert; wer produktiv arbeitet, trägt die Last.
Noch bedenklicher ist die Erosion der politischen Kultur. Die Fähigkeit zum offenen Diskurs schwindet. Viele Menschen meiden Diskussionen aus Angst vor sozialer Ächtung. Gesprächsbereitschaft und Diskussionsfähigkeit – einst Kennzeichen demokratischer Reife – sind einer Atmosphäre von Misstrauen und Feindseligkeit gewichen.
Ein Grundproblem liegt in der zunehmenden Politisierung der Gesellschaft. Immer neue Lebensbereiche werden zum Gegenstand staatlicher Steuerung und moralischer Kontrolle gemacht – von der Energieversorgung über Sprache und Bildung bis hin zur privaten Lebensführung. Doch je mehr das Politische in alle Lebensbereiche eindringt, desto stärker wachsen Zwiespalt und Misstrauen. Wo alles politisch wird, kann nichts mehr einfach menschlich oder sachlich bleiben.
Der falsche Ruf nach dem Staat lähmt das Land. Der Glaube, dass mehr Staat die Probleme lösen könne, ist die zentrale Illusion unserer Zeit. Je größer der Staatsanteil an der Wirtschaftsleistung, desto langsamer das Wachstum, desto geringer die Eigenverantwortung, desto schwächer die Freiheit.
Die Bürger zahlen immer höhere Steuern und Sozialabgaben, doch die Qualität öffentlicher Leistungen nimmt ab. Infrastruktur verfällt, Schulen verlieren an Niveau, Bürokratien wachsen ins Maßlose. In Wahrheit sind die meisten Missstände, die heute beklagt werden, nicht ohne, sondern durch den Staat entstanden.
Der Ausweg führt nicht über mehr Politik, sondern über weniger. Die Lösung liegt nicht in einer neuen Partei oder Ideologie, sondern in der Entpolitisierung des Lebens. Der Staat muss auf seine legitimen Kernaufgaben beschränkt werden: Rechtsschutz, Eigentumssicherung, Vertragserfüllung und äußere Sicherheit. Alles andere kann durch freie Institutionen, durch Märkte und durch zivilgesellschaftliche Strukturen besser geleistet werden.
Deutschland steht an einem Wendepunkt. Die Herausforderungen sind vielfältig – und tief miteinander verwoben: wirtschaftliche Schwäche, Staatsverschuldung, Energiepolitik, Migration, Demographie und Tabuisierung öffentlicher Debatten. Diese Probleme können nicht durch mehr Bürokratie, mehr Regulierung und mehr Gesetze gelöst werden. Sie verlangen eine Rückkehr zur Vernunft – zu marktwirtschaftlicher Ordnung, persönlicher Verantwortung und geistiger Offenheit.
Trotz aller Kritik bleibt die Perspektive nicht pessimistisch. Deutschland verfügt über enormes menschliches und intellektuelles Potenzial – über Wissenschaft, Unternehmertum, Kultur und eine tief verwurzelte Arbeitsethik. Wenn diese Kräfte wieder freigesetzt werden, jenseits der politischen Fesseln, kann das Land zu neuer Stärke finden. Freiheit beginnt dort, wo der Mensch selbst denkt, selbst handelt und Verantwortung übernimmt. Um diese Tugenden wieder zur Geltung bringen, braucht es nicht neue Staatsausgaben, neue Konjunkturpakete oder eine erneute Lockerung der Geldpolitik. Im Gegenteil: Weniger Politik, weniger Staat, weniger Reglementierung, weniger Geldinflation sind der Weg. Je konsequenter der Staatsabbau beschritten wird, desto eher kann es in Deutschland wieder zu einer wirtschaftlichen Erholung kommen.
Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft (IWD): Produktivitätslücke ist schwer zu schließen, September 2025
Antony P. Mueller: „Kapitalismus ohne Wenn und Aber“ (2018)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.