digitaler sozialismus: Digitaler Sozialismus und das Problem der wirtschaftlichen Kalkulation
Warum Big Data, Künstliche Intelligenz und Algorithmen die Logik des freien Marktes nicht ersetzen können
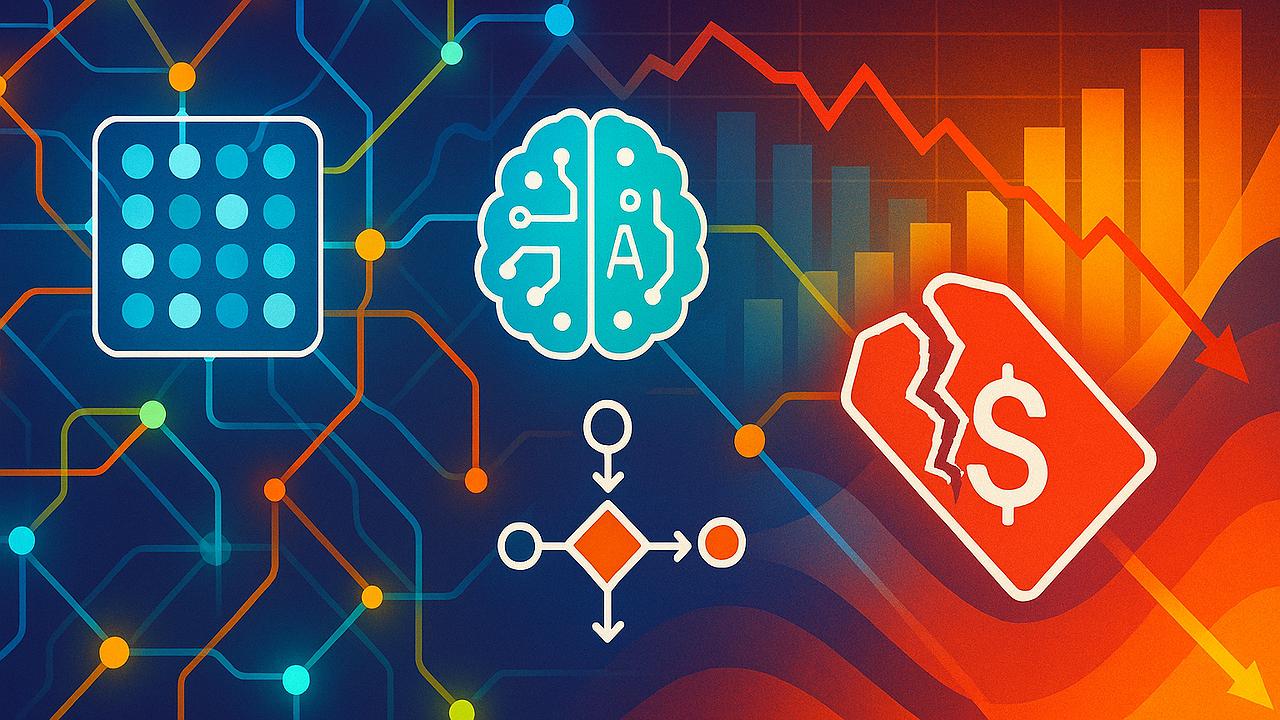
Digitaler Sozialismus und das Problem der wirtschaftlichen Kalkulation
Warum Big Data, Künstliche Intelligenz und Algorithmen die Logik des freien Marktes nicht ersetzen können
Vor über hundert Jahren formulierte der österreichische Ökonom Ludwig von Mises eine ebenso einfache wie tiefgreifende These: Eine komplexe Volkswirtschaft kann ohne genuine Marktpreise nicht rational kalkulieren. Preise fungieren als Maßstab für Knappheit; ohne diesen Maßstab fehlt jede Grundlage für fundierte Entscheidungen darüber, wie Ressourcen effizient verwendet werden sollen.
Friedrich August von Hayek ergänzte später, dass selbst eine künstliche Preisfestsetzung nicht ausreiche, da das notwendige Wissen über Bedürfnisse, Ressourcen und Alternativen zu verstreut, subjektiv und zeitabhängig sei, um zentral erfasst oder gesteuert werden zu können. Genau an diesen beiden Problemen – dem Fehlen eines Preismechanismus und der Unverfügbarkeit des dezentralen Wissens – ist der Sozialismus des 20. Jahrhunderts gescheitert. Bürokratische Planbehörden waren überfordert, informelle Märkte entstanden, und Versorgungsengpässe wurden zur Regel.
Heute erleben wir eine Wiederbelebung ähnlicher Ideen – diesmal jedoch unter neuen Vorzeichen:
„Big Data löst das Informationsproblem!“
„Künstliche Intelligenz kann alles optimal berechnen!“
„Preise sind überflüssig – wir haben schließlich Algorithmen!“
Die Vision eines „digitalen Sozialismus“, auch unter Begriffen wie „Technosozialismus“ oder „Fully Automated Luxury Communism“ bekannt, verspricht eine Zukunft, in der Superintelligenz und nahezu unbegrenzte Rechenleistung den Marktmechanismus überflüssig machen. Die Anhänger dieses Konzeptes entwerfen Szenarien, in denen der Kapitalismus durch automatisierte Planung abgelöst wird – ohne Wettbewerb, ohne Preissignale, ohne materielle Engpässe.
So attraktiv diese Vision erscheinen mag – sie bleibt theoretisch wie praktisch problematisch. Denn die grundlegenden Einwände von Mises und Hayek lassen sich auch mit modernster Technologie nicht aufheben.
Das Kalkulationsproblem ist das zentrale Strukturdefizit zentraler Planung.
Wie sollen in einer Volkswirtschaft die laufend fällig werdenden Entscheidungen getroffen werden? Wofür sollen knappe Ressourcen eingesetzt werden? Wie lässt sich diese Entscheidung rational treffen? Und vor allem: Wer soll diese Entscheidungen treffen?
In einer marktwirtschaftlichen Ordnung orientieren sich Konsumenten und Produzenten an den Marktpreisen. Der Preis bildet in einem einzigen Wert das Ergebnis unzähliger dezentraler Entscheidungen ab. In einem sozialistischen System hingegen existieren keine Marktpreise für Produktionsmittel. Der Staat – oder ein zentrales technisches System – müsste Mengen und Verteilungen selbst festlegen. Aber auf welcher Grundlage? Ohne echte Preise fehlt jede objektive Grundlage für die Allokation knapper Ressourcen. Die Folge sind notwendigerweise ineffiziente Entscheidungen, Verschwendung und Fehlproduktion.
Auch Big Data kann das Koordinationsproblem nicht lösen. Die Vertreter technosozialistischer Ansätze argumentieren, dass moderne Datenverarbeitung die Informationslücke zentraler Planung überwinden könne: Jede Transaktion, jeder Klick, jeder Sensor liefere Echtzeitdaten über Bedürfnisse und Präferenzen.
Doch diese Hoffnung verkennt mehrere fundamentale Probleme:
Erstens: Daten beschreiben Vergangenes – Entscheidungen betreffen die Zukunft. Selbst die leistungsfähigste KI kann exakt analysieren, was gestern verkauft wurde. Sie kann jedoch nicht verlässlich prognostizieren, ob morgen ein geopolitischer Schock die Lieferketten unterbricht oder ein gesellschaftlicher Trend die Nachfrage plötzlich verändert.
Zweitens: Die menschlichen Präferenzen sind subjektiv und dynamisch. Konsumentscheidungen beruhen nicht nur auf objektiven Kriterien, sondern auf wechselnden Stimmungen, Wertvorstellungen und Kontexten. Diese situative Subjektivität entzieht sich algorithmischer Vorhersagbarkeit.
Drittens: Wesentliche Informationen sind nicht digital erfassbar. Das wesentliche Wissen für wirtschaftliche Entscheidungen ist implizites Erfahrungswissen, das nicht systematisch formalisiert werden kann. Es handelt sich, wie Hayek es nannte, um „tacit knowledge“.
Viertens: Selbst wenn es perfektes Datenwissen gäbe, bliebe das Knappheitsproblem ungelöst. Angenommen, eine KI verfügte über vollständige Informationen: Auch dann könnte sie nicht gleichzeitig alle konkurrierenden Wünsche erfüllen. Woran soll sich die Priorisierung ausrichten? Gerade bei den wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen geht es oft gar nicht hauptsächlich um Wissen, sondern um die Bewertung von „trade-offs“.
Fünftens: Daten und Zahlen sind nicht neutral. Daten werden immer durch Auswahl, Interpretation und politische Interessen beeinflusst. Wer entscheidet, was gesammelt wird, welche Daten wichtig sind und wie mit widersprüchlichen Informationen umzugehen ist? Ein zentralisiertes System wird stets anfällig für Manipulation und Missbrauch sein.
Weder der Staat noch KI können Unternehmer ersetzen. Unternehmer übernehmen Risiken. Sie investieren eigenes Kapital in unsichere Zukunftsszenarien – mit der Aussicht auf Gewinn oder der Gefahr des Verlusts. Unternehmerisches Handeln besteht wesentlich im Entdecken neuer Bedürfnisse, Produkte und Märkte. Eine KI hingegen (und auch die Politik) kann nur innerhalb vorgegebener Parameter optimieren. Sie kann keine Innovationen hervorbringen, deren gesellschaftliche Relevanz noch unbekannt ist. Zudem verfügt sie über kein eigenes Vermögen – sie kann also auch keine Verantwortung im ökonomischen Sinne tragen. Fehler werden kollektiv getragen, Erfolge ebenso. Das entzieht dem System die nötige Disziplinierung durch Marktfeedback.
In der Marktwirtschaft geben Gewinne und Verluste klare Rückmeldungen über den Erfolg oder Misserfolg unternehmerischer Entscheidungen. In einem digital gesteuerten Sozialismus hingegen wäre Verantwortung diffus verteilt. Die Folge wäre keine höhere Effizienz, sondern eine digitalisierte Bürokratie – schneller, aber nicht notwendigerweise klüger.
Oft wird auf große Konzerne verwiesen, um zu zeigen, dass Zentralplanung und Effizienz zusammen bestehen können. Doch dieser Verweis verkennt den Kontext: Diese Unternehmen agieren innerhalb einer marktwirtschaftlichen Umwelt – sie kaufen Produktionsfaktoren auf funktionierenden Märkten ein und kalkulieren mit realen Preisen. Eine vollständig zentral geplante Weltwirtschaft hingegen hätte keine externen Preisanker mehr. Auch der beste Algorithmus verlöre dann seinen wichtigsten Informationsinput und stünde letztlich vor denselben Problemen wie die Planwirtschaften des 20. Jahrhunderts.
Je mehr Daten, Entscheidungsgewalt und Ressourcen in einem zentralen System gebündelt werden, desto größer ist das Risiko politischer Instrumentalisierung. Totalitäre Systeme demonstrieren bereits heute, wie digitale Technologien zur Kontrolle und Steuerung von Verhalten eingesetzt werden – inklusive sozialer Bewertungssysteme, flächendeckender Überwachung und politisch motivierter Ressourcenvergabe. Die Vorstellung, eine globale Super-KI könnte neutral, objektiv und im Interesse aller handeln, ist eine technologische Illusion – ohne historische und machtpolitische Fundierung.
Technologie ist ein mächtiges Werkzeug. Sie erhöht Produktivität, Lebensqualität und Informationszugang. Doch sie kann zentrale Prinzipien ökonomischer Ordnung nicht außer Kraft setzen. Komplexe gesellschaftliche Strukturen entstehen nicht durch zentrale Steuerung, sondern durch die dezentrale Koordination freier Individuen. Der Preismechanismus ist bislang das effizienteste Kommunikationssystem, das in Echtzeit individuelle Präferenzen, Knappheiten und Innovationspotenziale miteinander verknüpft – ohne dass hierfür ein Supercomputer erforderlich wäre.
Der sogenannte digitale Sozialismus ist kein Fortschritt, sondern ein Rückgriff auf überholte Steuerungsphantasien – lediglich in zeitgemäßer technischer Aufmachung. Wer Wohlstand und Selbstbestimmung sichern möchte, sollte daher auf das bewährte Zusammenspiel von Privateigentum, Preissignalen und persönlicher Verantwortung setzen. Denn nur in einer freiheitlichen Ordnung kann sich jene spontane Komplexität entfalten, die technokratische Systeme trotz aller Rechenleistung nicht erzeugen können.
Quellen:
https://www.amazon.de/-/en/Die-Gemeinwirtschaft-Untersuchungen-%C3%BCber-Sozialismus/dp/3828204112/
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.

