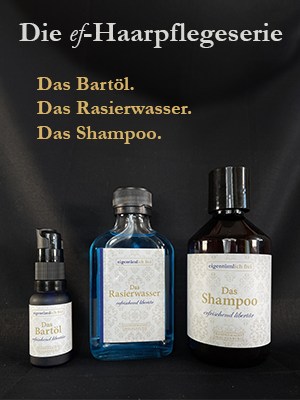Deutsche Justiz: Das Bundesverfassungsgericht und die Gewaltenteilung
Fehlende Machtbegrenzung staatlicher Organe
von Andreas Tögel drucken

Die Neubesetzung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland und die am Freitag, dem 11. Juli 2025 vom Bundestag beschlossene Verschiebung der Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt, wurde von beiden Seiten heftig debattiert. Der Streit entzündete sich bekanntlich hauptsächlich an der Personalie der von der SPD nominierten Frauke Brosius-Gersdorf, die unter anderem mit einer mehr als problematischen Stellungnahme zur Menschenwürde aufgefallen war und daher von den verbliebenen Konservativen in den einst christsozialen Parteien (und selbstverständlich von den Mandataren der AfD) abgelehnt wird.
Abseits der kontroversiellen Debatte um die Person einer profilierten Ultralinken für ein derart mächtiges Amt wurden und werden grundsätzliche und wesentlich wichtigere Überlegungen gar nicht erst angestellt.
Die allegorische Darstellung der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit, enthält wesentliche Elemente, die bis ins Mittelalter und in die Neuzeit hineinwirken. Ihre Waage steht für das sorgfältige Abwägen der Argumente, das Schwert für die Durchsetzungskraft des Rechts – notfalls mit Gewalt – die Augenbinde schließlich für die Unparteilichkeit ihres Urteils ohne Ansehen der Person. Kann die Ausgewogenheit von Urteilen und deren Unparteilichkeit von einer radikal linken Kandidatin erwartet werden?
Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, verdanken wir die Idee der Gewaltenteilung, die er im zweiten Teil seines 1748, also in der Frühzeit der Aufklärung veröffentlichten Hauptwerks „Vom Geist der Gesetze“ erläutert. Um die Freiheit des Bürgers zu garantieren, müssen die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt strikt voneinander getrennt werden. Dieser zu seiner Zeit bahnbrechende Gedanke findet sich im politischen System der USA unter dem Begriff „Checks and Balances“ (Kontrollen und Ausgleiche) wieder, die ebenfalls für die Unabhängigkeit und gegenseitige Kontrolle dieser drei Bereiche stehen.
Das Ziel der Gewaltenteilung besteht in einer Machtbegrenzung staatlicher Organe, dem Schutz der Bürger vor einer übergriffigen Obrigkeit und der Wahrung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Eine Gewaltenteilung, die diesen Namen tatsächlich verdient, sorgt dafür, dass politische Entscheidungen immer von mehreren Seiten unabhängig voneinander geprüft werden.
Ob von einer Gewaltenteilung dann noch die Rede sein kann, wenn die höchsten Funktionäre der Justiz von der gesetzgebenden Körperschaft (in der gelebten Praxis faktisch von der Regierung!) weniger mit Blick auf die Qualifikation der Kandidaten, sondern mehr nach politischer Opportunität gekürt werden, darf bezweifelt werden.
Seit Jahren ist in Deutschland und Österreich der Trend zur „Emanzipation“ der Parlamente vom Elektorat unübersehbar: In beiden Ländern bestehen deutliche Wählermehrheiten für Parteien rechts der Mitte, was die politische Klasse allerdings nicht daran hindert, ungeniert linke Regierungen zu bilden. Die Nomenklatura tritt den Wählerwillen mit Füßen. Eingedenk dessen ist kaum anzunehmen, dass Richter, die von Parlamentariern berufen werden, die sich ihren Wählern längst nicht mehr verpflichtet fühlen, überhaupt noch einen Funken von Bodenhaftung aufweisen werden.
Der konservative österreichische Journalist und Blogger Andreas Unterberger weist unter dem Aufhänger „Wenn die Justiz sich auch zum Gesetzgeber macht“ darauf hin, dass etwa der Europäische Menschrechtsgerichtshof immer mehr Lust verspürt, selbst die Regeln zu setzen und – ohne jede demokratische Legitimation – nach Lust und Laune rechtmäßig zustande gekommene Gesetze zu Fall bringt wie etwa in den Bereichen Abschiebungspraxis oder Familienzusammenführung. Letztere hat sich inzwischen EU-weit zu einem veritablen Problem ausgewachsen.
Gegen einen Missbrauch der Justizmacht ist indes kein Kraut gewachsen, da die Richter – anders als politische Mandatare – auch theoretisch keinerlei negative Konsequenzen ihres Handelns zu befürchten haben.
Wie formulierte es der altösterreichische Ökonom und Sozialphilosoph Ludwig von Mises so treffend: „Der Staatsapparat ist ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat“(„Im Namen des Staates oder die Gefahren des Kollektivismus“).Damit ist alles gesagt. Staatliche Richter sind nichts weiter als Handlanger eines „Zwangs- und Unterdrückungsapparats“. Sie liefern allenfalls Urteile. Augenmaß und Gerechtigkeit können von ihnen nicht erwartet werden.
Eine anekdotische Bemerkung zum Schluss sei noch gestattet: Prof. Karl Wenger vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien bemerkte in einer seiner Vorlesungen zum Bundes-Verfassungsgesetz sinngemäß, „dass diejenigen Juristen, die etwas im Kopf haben, in die Wirtschaft gehen oder als Rechtsanwälte praktizieren, während diejenigen, die eher auf ihr Sitzfleisch vertrauen, lieber Richter oder Staatsanwälte werden“. Der Mann – er ruhe in Frieden – war selbst wohlbestallter Beamter und musste daher wissen, wovon er redet.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.