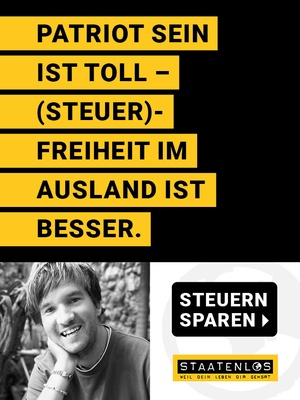US-Handelspolitik: Trumps vom Zaun gebrochener Zollkonflikt
Eine „geschredderte” WTO
von Klaus Peter Krause drucken

Politiker von heute sind ökonomisch meist schlichte Gemüter – politisch folglich ebenfalls. Denn was sie ökonomisch nicht verstehen und daher mit ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik in den Sand setzen, ist mit den Folgen für Unternehmen und Bürger stets auch schlechte Politik. Wohl haben sie viele sachkundige Berater. Wohl fragen sie die auch um Rat. Wohl pflegen sie ihn von denen auch zu erhalten. Aber wenn die Ratschläge ihnen politisch nicht in den Kram passen und sie diese in den Wind schlagen, nützt die beste Ökonomie nichts, die Folgen sind ihnen dann egal. Gar fremd ist ihnen der schöne lateinische Sinnspruch „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“ (zu Deutsch: Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende). Sie bedenken das Ende nicht. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Eines davon ist im Außenhandel der vom Zaun gebrochene Zollkonflikt. Seit Donald Trump in den USA wieder als Präsident agiert, hat er ihn zu einem beherrschenden Thema gemacht.
Warum Zölle politisch überaus beliebt sind
Es gibt Zölle auf den Im- und auf den Export. Der Staat erhebt sie auf Wirtschaftsgüter (Waren und Dienstleistungen). Er tut das entweder nur deswegen, weil er Geld braucht (Fiskalzoll). Oder deswegen, weil er seine Wirtschaft ganz oder branchenweise vor Preiswettbewerb durch Importgüter schützen will (Schutzzoll). Oder deswegen, weil er den Export heimischer Güter ver- beziehungsweise behindern will, um die eigenen Bürger vor einer Verknappung oder gar einem Ausverkauf zu bewahren. Oder ein Staat (oder eine Staatengemeinschaft) führt Importzölle gegen andere Staaten deswegen ein, um sie für irgendetwas zu bestrafen (Sanktionszoll), siehe die Strafzölle gegen Putins Russland wegen dessen Krieg mit der Ukraine. Aber Zoll aus welchem Motiv auch immer: Wer stets von den zusätzlichen Einnahmen profitiert, ist im zollerhebenden Staat dessen Fiskus. Eben darum sind Zölle – unabhängig von ihrem Zweck – politisch so überaus beliebt.
Jeder Zoll ist eine staatliche Intervention in den freien Markt
Am häufigsten und gebräuchlichsten sind Schutzzölle auf Importgüter. Diese Güter werden für die eigenen Bürger künstlich verteuert, damit diese die heimischen Güter vorziehen und vom Kauf der Importgüter die Finger lassen. Jeder Zoll ist ein staatlicher Eingriff in die Preisbildung, eine Intervention in den freien Markt. Zölle verändern durch den Preisanstieg nicht nur das Niveau der Preise, sondern durch Unterschiede in der Zollhöhe auch die Preisrelation, also das Verhältnis der Preise zueinander. Die Freiheit im Wettbewerb und durch Wettbewerb wird eingeschränkt.
Zölle werden früher oder später zum Bumerang
Wettbewerbsbeschränkungen haben Folgen. Zunächst sind es – falls die Regierenden Glück haben – die gewünschten Folgen. Haben sie Pech, treten diese kaum oder gar nicht ein. Nämlich deshalb, weil die Regierenden nicht alles zu bedenken vermögen, was ihnen die Märkte mit ihren vielen Menschen an Beweglichkeit und Geschick voraushaben. Es kommt zu Ausweichbewegungen oder sie finden Ersatzlösungen. Denn die Menschen auf den Märkten sind erfindungsreich und tricksen die überraschten Regierenden häufig aus, wodurch diese wiederum mit den Zöllen nicht den gewollten Zweck erreichen. Hinzu kommen mit der Zeit Langzeitfolgen, die Branchen gewöhnen sich an den Schutz, werden träge, weil der Wettbewerbsdruck fehlt, ihre Innovationskraft lässt nach und schläft schließlich ganz ein. Andere Länder greifen zu Gegenzöllen. So werden Zölle früher oder später zum Bumerang.
Politik mit Zöllen ist ökonomisch stets schlechte Politik
Politik mit Zöllen ist ökonomisch stets schlechte Politik. Wirtschaftlich bringt sie den Bürgern nur Nachteile, spätestens auf lange Sicht. Die Regierenden und ihre Parteien denken nur in kurzen Zeiträumen. In der Regel sind das die Wahlperioden. Sie hangeln sich von einer Periode zur nächsten, leben mit dem verfügbaren Geld (Steuereinnahmen und aufgenommenen Krediten) gleichsam von der Hand in den Mund. Regieren auf Pump. Sie halten das Zurücklegen von Geld, Sparen genannt, für Ersatz- und Neuinvestitionen für abwegig. Das Geld wird verjubelt. Die einstige vor Inflation schützende Tugend „Erst sparen, dann investieren“ ist dahin. Die Herrschaft übernommen hat die Geldschöpfung aus dem Nichts, also das schier unerschöpfliche „Fiatgeld“. Die Zentralbanken, die den Geldwert schützen sollten, spielen mit und sind den Regierenden mehr oder minder zu Diensten.
„To make America great again“ sollen andere Staaten mit Zöllen finanzieren helfen
Den Zollkonflikt losgetreten hat US-Präsident Donald Trump, seit er als solcher wieder amtiert. Die USA haben gegenüber anderen Ländern Handelsdefizite, die Trump nicht mag. Mit Zöllen will er sie unter anderem bekämpfen. Als Hegemon können sich die USA Willkürlichkeiten leisten und Trump nutzt diese Machtstellung ohne Hemmungen aus. Trump will Amerika „great again“ machen. Dafür braucht er Geld – das von anderen Staaten. Liefern sollen ihm das Geld Einfuhrzölle. Sie sind ihm Fiskal- und Schutzzoll, teils auch Sanktionszoll zugleich. Wer nicht spurt, bekommt höhere Zölle aufgebrummt. Die betroffenen Staaten empören sich. Dann wird geschachert oder. diplomatischer formuliert: verhandelt. Jetzt ist der alte Kaufmann und Dealmaker Trump in seinem Element. Mit seiner Zollpolitik hält er die Weltwirtschaft in Atem.
Kanada und Mexiko verpasste Trump Zölle gleich bei seiner Amtseinführung
Gleich am Tag seiner Amtseinführung, am 20. Januar 2025, verkündete Trump, dass am 1. Februar auf Importe aus Kanada und Mexiko Zölle in Höhe von 25 Prozent in Kraft treten würden. Gegen Einfuhren aus China hatte er im Wahlkampf Zölle von bis zu 60 Prozent angekündigt. Nun wies er die zuständigen Bundesbehörden an, die Handelsbeziehungen mit China genauer zu prüfen und vorzuschlagen, wie sich „unfaire Handelspraktiken und Währungsmanipulationen“ weltweit unterbinden ließen. Die EU könne um Zölle herumkommen, wenn sie von den USA „sehr viel“ Öl und Flüssiggas kaufe, sagte Trump. Das große Handelsbilanzdefizit mit der EU ist für ihn immer noch ein Ärgernis, ebenso wie EU-Einfuhrbeschränkungen für Autos und Agrargüter aus den USA („Faz“ vom 22. Januar 2025, Seite 1).
Der Zoll-Deal mit der Europäischen Union
In der Folgezeit setzte Trump seine Zollpolitik fort und die davon betroffenen Staaten versuchten, sich dagegen zu wehren, und in den sich anschließenden Verhandlungen wurde und wird gefeilscht. Dabei scheuten und scheuen die USA als Hegemon vor Drohungen nicht zurück. Der EU hatte Trump für ein Zollabkommen eine Frist bis zum 9. Juli gesetzt. Die wurde dann bis zum 1. August gnädig verlängert. Das Abkommen ist inzwischen im schottischen Turnberry unterzeichnet worden. Der „Deal“ sieht vor, dass die USA ab sofort einen Zoll von 15 Prozent auf fast alle Importe aus der EU erheben. Im Gegenzug hat die EU zugesagt, die Zölle auf USA-Produkte in den meisten Fällen auf null zu senken. Ausgenommen davon sind bis auf Weiteres Stahl- und Aluminiumprodukte; auf die die USA vorerst weiter 50 Prozent Zoll erheben. Zahlreiche Details des „Deals“ sind noch offengeblieben und sollten weiter ausgehandelt werden. Noch nicht im Detail ausverhandelt, aber offenbar von beiden Seiten beabsichtigt, ist, dass auf bestimmte Produkte von „strategischer Bedeutung“ generell keine Zölle erhoben werden. Dazu zählen Flugzeuge und Flugzeugteile, Generika und bestimmte chemische Produkte („Faz“ vom 6. August 2025, Seite 16).
Für die EU ein Akt der politischen Demütigung
In der „Faz“ las man zu dem Abkommen: „Der oktroyierte ‚Giant Deal‘, dem die EU-Kommissionspräsidentin mit honigsüßem Lächeln zugestimmt hat, war ein Akt der politischen Demütigung. Er illustriert, wie tief der alte Kontinent in der Krise steckt. Das Brüsseler Gerede vom geopolitischen Player und der strategischen Autonomie wurde in anderen Teilen der Welt schon lange belächelt; man muss nur das europäische Wirken in der Ukraine und in Nahost betrachten. Aber nun erlebt die EU, dass auch ihr Ruf als ökonomische Großmacht leidet.“ Jahrzehnte selbstzufriedener, wenig vorausschauender Politik hätten Deutschland und Europa erpressbar gemacht. Weil in Vergessenheit geraten sei, dass internationale Politik am Ende immer Machtpolitik sei, könne Europa nicht mehr souverän handeln („Faz“ vom 3. August 2025, Seite 8: „Eine weitere Demütigung Europas“).
Mit ihren Zolleinnahmen hat die EU auch eigene Interessen
Zuvor hatte Peter Boehringer, Fachmann für Wirtschaft und Finanzen sowie stellvertretender Bundessprecher der AfD, kommentiert: „Das Beste, was den Verhandlern auf beiden Seiten des Atlantiks passieren könnte, wäre ein echtes Freihandelsabkommen mit null Prozent Zöllen auf alle Produkte. Dazu müsste sich jedoch nicht nur Donald Trump bewegen, sondern in erster Linie die EU und die sie tragenden Staaten. Nach wie vor erhebt die EU höhere Zölle auf US-Waren als umgekehrt. Auch der Anteil der zollfreien Importe ist in der EU deutlich geringer. Ob die EU jedoch zu einem echten Freihandelsabkommen bereit ist, muss nicht zuletzt deshalb bezweifelt werden, weil die Zolleinnahmen in der EU direkt an die EU und nicht an die Mitgliedstaaten fließen. Wie so oft hat die EU also auch eigene Interessen, die mit den Interessen der Mitgliedstaaten nicht übereinstimmen. Keinesfalls ist davon auszugehen, dass die EU auf diese ihr zugesicherten Mittel einfach verzichten wird.“
Die Bremser für Freihandel sitzen auch in Brüssel und Berlin, nicht nur in Washington
Zwar, so Boehringer weiter, geriere sich die EU öffentlich gerne als Advokatin des Freihandels, doch verfolge sie geradezu regelmäßig eine entgegengesetzte Politik, etwa beim CO2-Grenzausgleichssystem, beim Lieferkettengesetz oder auch bei TTIP. In allen diesen Belangen habe die EU stets das Gegenteil von Freihandel vertreten, auch bei TTIP, das angesichts seines Umfangs von mehreren Hundert, teilweise geheim verhandelten Seiten beileibe kein echtes Freihandelsabkommen gewesen sei. Die Bremser für Freihandel säßen nicht nur in Washington, sondern auch in Brüssel und Berlin (Boehringer am 8. Juli 2025, siehe untenstehenden Link).
Trumps Zolldiktate widersprechen auch den USA-Gründungsidealen
Unter der Überschrift „Ein Königreich für einen Zoll“ kommentierte Winand von Petersdorff im Wirtschaftsteil der „Faz“: „Der Anspruch des Präsidenten Donald Trump, Zölle eigenmächtig zu erlassen, berührt nicht nur wirtschaftliche Fragen, sondern das Selbstverständnis der amerikanischen Demokratie. Seine Regierung interpretiert den International Emergency Economic Powers Act von 1977 als ein Ermächtigungsgesetz, das dem Präsidenten erlaubt, jeden beliebigen Zollsatz gegen jedes beliebige Land zu jeder beliebigen Zeit und aus nahezu jedem beliebigen Grund zu verhängen. Diese Deutung ist nicht nur juristisch umstritten, wie das Urteil des Internationalen Handelsgerichts zeigt. Sie widerspricht auch den Gründungsidealen der Vereinigten Staaten. Das Land entstand aus dem Widerstand gegen die Willkür der britischen Krone. Die Bürger der dreizehn Kolonien rebellierten nicht nur gegen hohe Steuern, sondern gegen die Tatsache, dass diese Steuern ohne ihre Mitwirkung festgelegt wurden. ‚No taxation without representation‘ war der Leitspruch der Revolutionäre – keine Besteuerung ohne parlamentarische Vertretung. Zölle standen im Zentrum der Konflikte“ („Faz“ vom 5. August 2025, Seite 15).
„Die Zölle sind ein Akt der ökonomischen Selbstverstümmelung“
VDM-Präsident und studierter Historiker Bertram Kawlath bringt Trumps Zollpolitik auf diesen kurzen Nenner: „Die Zölle sind ein Akt der ökonomischen Selbstverstümmelung. Es mag aktuell für die Administration von Trump so scheinen, dass man sehr hohe Einnahmen schafft und das Märchen, dass andere Nationen diese Zölle zahlen, scheint sich leider auch bei uns festzusetzen. Es stimmt aber nicht“ (Im Interview mit der „Faz“ vom 7. August 2025, Seite 22). Im gleichen Interview sagt Kawlath: „Wir müssen als EU wieder lernen, Freihandel voranzutreiben, damit wenigstens wir noch als Bastion eines möglichst regelbasierten Freihandels gelten. Gerade für unsere mittelständisch geprägte Industrie sind diese Freihandelsabkommen sehr wichtig, um andere Märkte auch zu erschließen.“ Der VDMA ist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., ein großer Industrieverband und die wichtigste Interessenvertretung für die deutsche und europäische Investitionsgüterindustrie. Er repräsentiert über 3.600 meist mittelständische Mitgliedsunternehmen der Branche.
Ein Anschlag auf die WTO und die Meistbegünstigung
Längst ist klar, dass sich Trump-Amerika, die EU und andere Staaten nicht mehr an die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) halten. Trump hält ohnehin nicht viel von internationalen Organisationen. Aber die EU hatte sich bisher als Hüterin eines regelgebundenen Welthandels dargestellt. Das Zollabkommen mit den USA nimmt ihr diese Rolle. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel stellt nüchtern fest: „Was die EU macht, ist ein Anschlag auf die WTO.“ Die EU verhalte sich nicht anders als zum Beispiel Japan. „Jeder sucht sein Heil in bilateralen Verträgen mit den USA und schließt Dritte davon aus. Die WTO ist geschreddert.“ Mit dem Abkommen hat die EU das Prinzip der Meistbegünstigung gebrochen. Danach müssen Vorteile, die einem Handelspartner gewährt werden, auch allen anderen WTO-Mitgliedern eingeräumt werden. Die EU hat den USA auf deren Industriegüter einen Nullzoll zugesichert. Der bisher bestehende Zoll ist zwar im Durchschnitt gering, soll nun aber ganz fallen. Diesen Vorteil erhalten jedoch nur die USA, nicht die anderen WTO-Mitglieder.
Jüngstes Gerichtsurteil erklärt die meisten Trump-Zölle für illegal
Ausgestanden ist der von Trump global losgetretene Zollkonflikt, erst einseitig Zölle zu verhängen, daraufhin den Protest der Opfer in Kauf zu nehmen und sich dann herabzulassen, bilateral samt Drohgebärden mit ihnen zu verhandeln, wohl noch lange nicht. Inzwischen gibt es Rückschläge. Ein Bundesberufungsgericht hat jüngst die meisten von Trump verhängten Zölle für illegal erklärt, sie bleiben aber bis zum 14. Oktober in Kraft. Bis dahin hat die Regierung Zeit, den Supreme Court anzurufen, und alles ist wieder in der Schwebe. Kurz vor Veröffentlichung des Urteils am Freitagabend (29. August) hatten Minister aus Trumps Kabinett vergeblich versucht, auf die Richter Druck auszuüben.
Letztlich alles ausbaden müssen stets die Regierten, nie die Regierenden. Denen droht als Schlimmstes nur die Abwahl. Findet die Abwahl tatsächlich statt, ist das für die Regierten wie ein Gnadenakt. Diese Gnade wird ihnen mit einiger Sicherheit nicht zuteilwerden.
Peter Boehringer: Bei den Zollverhandlungen hat man in Europa den Bock zum Gärtner gemacht
Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.