Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaftswachstum – wie und warum?
Über eine Illusion
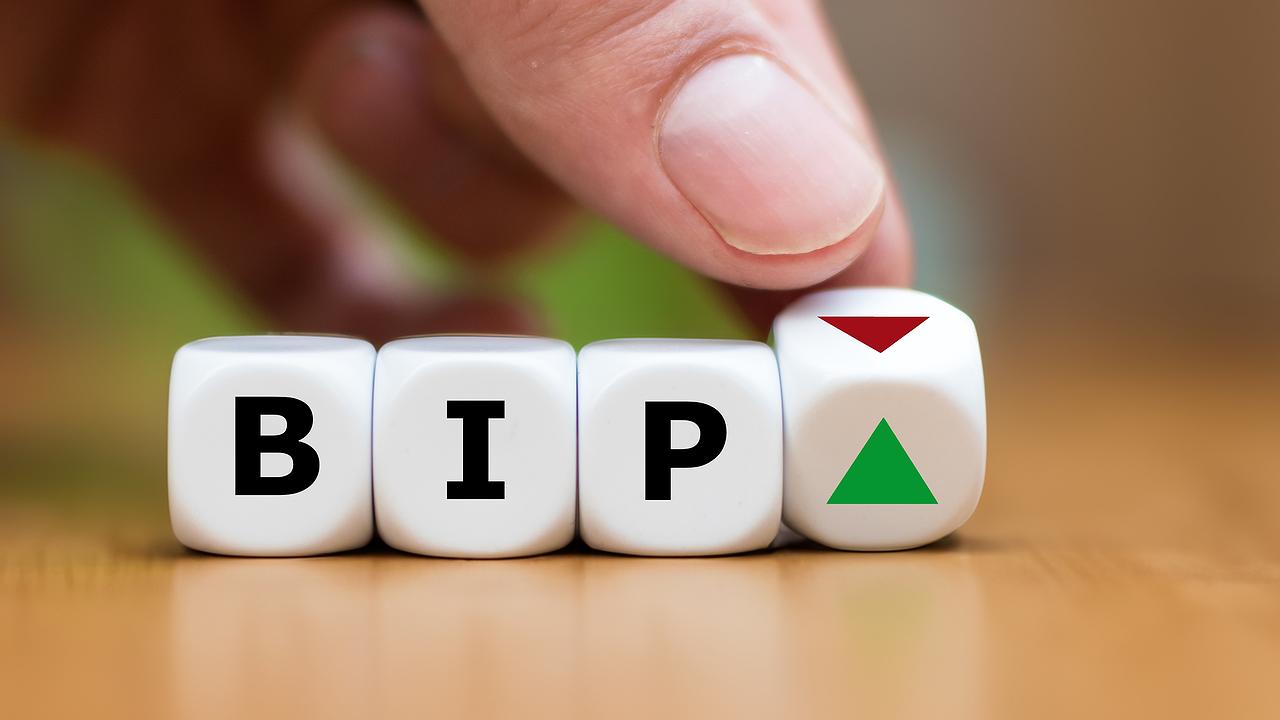
Kaum ein Begriff prägt die wirtschaftspolitische Diskussion so sehr wie das „Wachstum“. Wenn das Bruttoinlandsprodukt – kurz BIP – steigt, gilt das als Beweis für Fortschritt, Wohlstand und Erfolg. Politiker verweisen auf Wachstumsraten, um ihre Maßnahmen zu rechtfertigen, Zentralbanken stützen sich auf sie, um ihre Geldpolitik zu steuern, und Medien melden sie wie den Puls der Nation.
Doch was misst das BIP eigentlich? Spiegelt es den tatsächlichen Wohlstand einer Gesellschaft wider – oder nur die Summe aller bezahlten Aktivitäten, gleichgültig, ob sie nützlich, schädlich oder bloß statistisch sichtbar sind? Diese Fragen werden umso wichtiger, da viele westliche Länder seit Jahren mit stagnierendem oder schrumpfendem Wachstum kämpfen. Deutschland etwa hat 2024 nur noch ein sehr geringes Plus verzeichnet, trotz massiver Staatsausgaben und einer ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
Regierungen und Notenbanken versuchen, die Statistik zu beleben, indem sie Schulden ausweiten und Geld schöpfen. Doch das führt selten zu echtem Wohlstand, sondern eher zu einer Verschleierung der ökonomischen Realität. Es entsteht Wachstum auf dem Papier – aber kein Zuwachs an Produktivität, Kapital und nachhaltigem Reichtum. Wachstum ist nicht gleich Wohlstand. Ein Blick auf die deutschen Zahlen verdeutlicht den Unterschied. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 2024 rund 4.330 Milliarden Euro. Zieht man davon die Abschreibungen ab – also den Wertverlust durch die Abnutzung von Maschinen, Gebäuden und Anlagen –, bleibt ein Nettoinlandsprodukt von etwa 3.440 Milliarden Euro. Der Unterschied von fast 900 Milliarden Euro zeigt, dass ein erheblicher Teil der Produktion nur dazu dient, das bereits Bestehende zu erhalten. Das bedeutet: Ein Teil des Wachstums ist bloß eine Reparaturleistung. Erst was darüber hinausgeht, kann in Konsum oder neue Investitionen fließen. Wachstum ist also nicht automatisch Wohlstandsmehrung. Es kann auch heißen, dass immer größere Anstrengungen nötig sind, um denselben Lebensstandard zu bewahren. Zudem misst das BIP nur monetäre Aktivität, nicht aber deren Qualität. Wenn ein Sturm Dächer zerstört, steigen die Ausgaben für Reparaturen – das BIP wächst. Wenn Familien dagegen ihre Häuser selbst pflegen, ohne Geld auszugeben, fällt das nicht ins Gewicht. Diese Blindheit gegenüber der Substanz ist eine der größten Schwächen des gängigen Wachstumsbegriffs.
Damit Wachstumszahlen etwas aussagen, muss man die Inflation herausrechnen. Denn wenn Preise steigen, wächst zwar die Geldsumme, aber nicht unbedingt die reale Produktion. Die Statistik versucht, diesen Effekt mit Preisindizes zu korrigieren. Der Laspeyres-Index berechnet die Preisänderung anhand eines Warenkorbs aus einem früheren Basisjahr. Weil er alte Konsumgewohnheiten zugrunde legt, überschätzt er oft die Inflation. Der Paasche-Index nutzt dagegen den aktuellen Warenkorb und unterschätzt dadurch die Inflation. Der Fisher-Index, ein geometrisches Mittel aus beiden Methoden, gilt als die ausgewogenste Lösung
In der Praxis verwenden Institutionen wie die Europäische Zentralbank den sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Doch viele Ökonomen kritisieren, dass dieser Index Preissteigerungen bei Vermögenswerten – etwa Immobilien oder Aktien – ausblendet und so die tatsächliche Geldentwertung unterschätzt. Das Ergebnis: Offiziell scheint das Wachstum solide, doch real schrumpft die Kaufkraft. Viele Menschen spüren diese Diskrepanz direkt – ihre Mieten, Energiekosten und Lebensmittelpreise steigen deutlich schneller als die offizielle Inflationsrate.
Nicht jedes Wachstum ist real. Echtes kapitalistisches Wachstum entsteht, wenn mehr produziert wird, weil sich Wissen, Technologie und Kapitalstock erweitern. Scheinwachstum dagegen entsteht, wenn bloß mehr Geld in Umlauf kommt. Wenn die Zentralbank Zinsen künstlich niedrig hält und die Geldmenge erhöht, steigen zunächst Konsum und Investitionen. Doch das ist trügerisch. Es werden Projekte begonnen, die nur unter den Bedingungen des billigen Geldes rentabel erscheinen. Früher oder später zeigt sich, dass diese Investitionen auf Sand gebaut sind. Die Preise steigen, die Ersparnisse verlieren an Wert, und die Wirtschaft fällt in eine Krise. Die Österreichische Konjunkturtheorie erklärt dieses Muster als „Boom-and-Bust-Zyklus“. Der künstliche Boom, ausgelöst durch billiges Geld, endet unvermeidlich im Bust – der Phase der Bereinigung, in der Fehlentwicklungen korrigiert werden. Nur diese Krise schafft wieder Raum für echtes, tragfähiges Wachstum.
Die Quellen des Wohlstands sind Kapitalbildung und Arbeitsteilung. Wachstum entsteht nicht durch Geldausgabe, sondern durch Kapitalbildung. Das bedeutet: Menschen sparen einen Teil ihres Einkommens, um zu investieren. Dadurch werden Maschinen gebaut, Fabriken errichtet und neue Technologien entwickelt. Mit jedem Zuwachs an Kapital wächst die Produktivität der Arbeit.
In einer modernen Wirtschaft hängt der Wohlstand jedes Einzelnen von der Produktivität vieler anderer ab. Ein Softwareentwickler in München profitiert von der Präzision eines Werkzeugmachers in Baden-Württemberg und von der Energieversorgung in Norwegen. Diese Arbeitsteilung ist die eigentliche Quelle des Fortschritts. Je weiter sich die Arbeitsteilung entwickelt, desto höher ist der Lebensstandard. Wachstum bedeutet daher nicht bloß mehr Output, sondern eine immer feinere Koordination zwischen Millionen individueller Entscheidungen – eine spontane Ordnung, die nur in einer freien Marktwirtschaft entstehen kann.
Märchenerzähler gibt es in der Ökonomie ebenso, wie zum Beispiel auch die Medizin ihre Quacksalber hat. Hier wie dort werden Heilmittel verkündet, die nichts taugen oder sogar schädlich sind. In jüngerer Zeit hat eine neue Schule – die Moderne Monetäre Theorie (MMT) – die Vorstellung populär gemacht, dass Staaten unbegrenzt Geld schaffen könnten, solange ungenutzte Ressourcen vorhanden sind. Die Idee klingt verführerisch: Kein Mangel an Geld, kein Problem der Finanzierung, nur politische Prioritäten. Doch dieser Ansatz verwechselt Buchhaltung mit Wirklichkeit. Geldschöpfung schafft kein reales Kapital und keine zusätzliche Produktivität. Sie verschiebt lediglich die Kaufkraft: Diejenigen, die das neu geschaffene Geld zuerst erhalten – meist Banken, Staat und Finanzmärkte – profitieren. Wer später damit bezahlt, etwa Arbeitnehmer und Sparer, verliert an Wert. Dieser „Cantillon-Effekt“ führt zu Ungleichheit und Kapitalfehlleitungen. Die MMT erklärt Wachstum auf dem Papier, nicht in der Realität. Ihr Ergebnis ist Inflation, nicht Wohlstand. Wirkliches Wachstum ist kein Selbstzweck und keine rein statistische Größe. Entscheidend ist nicht, dass die Wirtschaft wächst, sondern wie sie wächst. Eine Zunahme des BIP ist bedeutungslos, wenn sie durch Schulden, Subventionen und Preisblasen zustande kommt.
Die Österreichische Schule der Nationalökonomie zeichnet sich durch ihre methodologische Individualität, Subjektivität und realitätsnahe Theorie des Handelns aus. Während der keynesianische Ansatz auf mathematische Modelle, Gleichgewichtsannahmen und statistische Aggregationen setzt, beginnt die Österreichische Schule beim handelnden Individuum. Sie betrachtet die Wirtschaft nicht als mechanisches System, das man steuern kann, sondern als einen lebendigen Prozess menschlicher Entscheidungen, der von Wissen, Erwartungen und Unsicherheit geprägt ist. Anstatt „die Wirtschaft“ als Ganzes zu modellieren, analysiert sie, wie Menschen aufgrund subjektiver Wertvorstellungen handeln, wie Preise als Signale entstehen und wie sich aus individuellem Handeln spontane Ordnungen wie Märkte oder Geldsysteme entwickeln. Diese praxeologische Perspektive – die Lehre vom menschlichen Handeln – lehnt die Vorstellung ab, dass wirtschaftliche Prozesse durch staatliche Planung, Geldschöpfung oder mathematische Optimierung effizient gesteuert werden können. Stattdessen betont sie die Bedeutung von Eigentumsrechten, Unternehmertum und Marktprozessen als Träger echter wirtschaftlicher Koordination und des Fortschritts. Echtes Wachstum in diesem Sinne beruht auf vier Säulen: Sparen, Investieren, Innovation und freier Handel. All diese Prozesse erfordern Zeit, Vertrauen und stabile Eigentumsrechte. Werden sie durch staatliche Eingriffe, Schuldenpolitik oder übermäßige Regulierung gestört, wird Wachstum nicht gefördert, sondern verhindert.
Deutschland, wie viele andere Industrieländer, steht heute genau an diesem Punkt: hohe Steuern, überbordende Bürokratie, demographischer Druck und eine Geldpolitik, die die Illusion des Wachstums nährt. Was fehlt, ist die Rückbesinnung auf das Fundament echten Wohlstands – Kapitalbildung, Unternehmertum und Eigenverantwortung.
Wirtschaftliches Wachstum ist letztlich ein geistiger Prozess. Es beginnt mit Ideen, die in Handlungen umgesetzt werden, und mit Vertrauen, das Investitionen ermöglicht. Staat und Zentralbank können Rahmenbedingungen schaffen – aber sie können Wachstum nicht befehlen. Nur dort, wo Freiheit, Eigentum und Marktmechanismen wirken, entsteht nachhaltiger Wohlstand. Das Ziel sollte daher nicht „mehr Wachstum“ um jeden Preis sein, sondern besseres Wachstum – Wachstum, das auf realer Wertschöpfung beruht, nicht auf statistischen oder monetären Tricks.
Dieser Artikel beruht auf einem Vortrag, den der Autor am 17. September dieses Jahres in Münster bei einer Veranstaltung der Atlas-Gesellschaft zusammen mit dem Hayek-Club gehalten hat.
Antony P. Mueller: „Kapitalismus ohne Wenn und Aber. Wohlstand für alle durch radikale Marktwirtschaft“Es (2018)
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.

