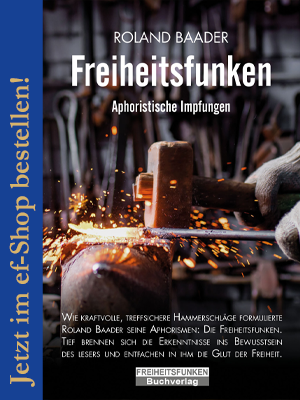Macht und Moral (I): Der Melierdialog
Nur die Macht zählt

Wir leben in der Illusion, dass Gerechtigkeit regiert. Doch Gerechtigkeit ist kein weltliches Gesetz. Es ist eine Geschichte, die wir erzählen, um das Leben erträglich zu machen.
Wir schreiben das Jahr 416 v. Chr.
Der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta dauert nun schon seit 15 brutalen Jahren. Athen, das sich auf dem Höhepunkt seiner Macht befindet, richtet seine Aufmerksamkeit auf die kleine, neutrale, unabhängige und wehrlose Insel Milos (Melos). Die Melier sind Nachkommen Spartas, haben sich aber aus dem Konflikt herausgehalten. Sie glauben, dass Gerechtigkeit, Frömmigkeit und Vernunft sie schützen werden. Sie irren sich. Athen fordert die Kapitulation. Was folgt, ist keine Schlacht, sondern ein Gespräch. Es ist einer der eindringlichsten Dialoge der Geschichte.
Macht ist der Tugend gegenüber gleichgültig
Die Melier beginnen mit ihrem Glauben. Sie appellieren an die Gerechtigkeit. Sie sprechen von Fairness, göttlicher Gunst und Hoffnung. Sie sagen: „Wir sind neutral. Wir hätten niemandem Schaden zugefügt. Sicherlich werden die Götter die Unschuldigen verteidigen und die Gerechten werden nicht vernichtet werden.“ Ihre Worte spiegeln den moralischen Instinkt der Menschheit wider. Sie glauben, dass Recht über Macht steht.
Die Melier sprechen als moralische Wesen in einem moralischen Universum. Aber die Athener teilen ihre Illusion nicht. Die athenischen Gesandten antworten mit einem Ton, der so kalt wie Marmor ist. „Ihr wisst genauso gut wie wir, dass Diskussionen über Gerechtigkeit nur zwischen Gleichberechtigten möglich sind. Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen leiden, was sie müssen.“
In ihrer Stimme liegt keine Grausamkeit, nur Gewissheit. Sie nennen das Vernunft. Gerechtigkeit, so argumentieren die Athener, habe keinen Platz in Verhandlungen, in denen eine Seite das Ergebnis diktieren kann. Die Welt, so betonen sie, werde nicht von Fairness regiert, sondern von der Notwendigkeit, vom Gesetz des Überlebens selbst.
Die Melier flehen erneut. Sie rufen die Götter an, im Glauben, dass die göttliche Gerechtigkeit Athen für seine Arroganz bestrafen wird. Sie appellieren an die Ehre, in der Hoffnung, dass Mut Respekt hervorruft. Die Athener bleiben unbeeindruckt. Hoffnung ist von Natur aus der Trost der Schwachen. Die Athener warnen: „Ihr riskiert euer Leben für eine Illusion.“
Der Dialog spitzt sich zu und entzieht den Meliern jede moralische Verteidigung, bis nur noch die Wahrheit übrigbleibt. Macht ist der Tugend gegenüber gleichgültig.
Das Schicksal
Als die Melier sich weigern, sich zu unterwerfen, belagert Athen die Insel. Sie zerstören die Stadt, töten die Männer und versklaven die Frauen und Kinder.
Thukydides berichtet mit erschreckender Zurückhaltung. Keine Kommentare, keine moralische Empörung, nur eine Abfolge von Ereignissen. Er wollte, dass die Leser sehen, was passiert, wenn menschliche Ideale mit der Realität kollidieren. Die Lektion handelt nicht von Grausamkeit, sondern von Klarheit. Athen tat, was es konnte. Milos erlitt, was es erdulden musste. Das ist alles.
Warum beunruhigt uns dieser Dialog so sehr? Weil er eine Sprache spricht, die wir nicht hören wollen. Die Athener sind der menschliche Geist, wenn er seine Illusionen abgelegt hat. Sie sind keine Bösewichte, sondern denken klar. Ihre ruhige Logik entlarvt die Fragilität unserer moralischen Narrative.
Wir möchten glauben, dass Gerechtigkeit die Geschichte bestimmt. Doch diejenigen, die Macht haben, leben nach einem anderen Gesetz: Überleben, Vorteil und Notwendigkeit. Das ist kein Zynismus. Es ist eine Offenbarung. Thukydides zeigt, dass Moral nur innerhalb eines Gleichgewichts zwischen Gleichberechtigten existiert. Gerechtigkeit kann funktionieren, weil beide Seiten Verluste verursachen können.
Macht ist die Voraussetzung für Moral
Wenn die Macht verschwindet, bricht auch die Moral zusammen. Die Athener haben das instinktiv verstanden. Sie betrachten Mitgefühl als Gefühl und nicht als Strategie. Sie wissen, dass Gnade, wenn sie falsch angewendet wird, das eigene Überleben gefährdet. Aus ihrer Sicht ist Mitleid ein Luxus, den sich die Mächtigen nicht leisten können. Für moderne Ohren mag das grausam klingen. Doch ist es heute wirklich anders?
Als Thukydides die Geschichte des Peloponnesischen Krieges schrieb, hielt er nicht nur Ereignisse fest. Er sezierte die Anatomie der Macht selbst. Seine Lehre war einfach. Diejenigen, die glauben, dass Gerechtigkeit die Starken leitet, leben in einer Traumwelt.
Die Griechen haben das schon lange vor uns verstanden. Sie erzählten Geschichten nicht, um zu moralisieren, sondern um die tragische Struktur der menschlichen Natur aufzudecken. In ihren Mythen handelten die Götter nicht aus Gerechtigkeit, sondern aus Macht. Zeus schlug zu, Athene täuschte und Poseidon zerstörte. Ihre Moral war keine göttliche Gesetzgebung, sondern göttliche Begierde.
Doch da ist noch viel mehr
Die griechische Mythologie zeigt uns die Vorstellung der Menschen jener Zeit vom Jenseits. Die Götter kümmerten sich kaum um die Menschen, sie folgten schlicht ihren Instinkten. Was die Menschen auch taten, wie sehr sie auch flehten und opferten, den Göttern war es fast immer einerlei. Die Griechen begriffen, dass sie sich nicht auf die Götter verlassen konnten. Also entwickelten sie Logik und Mathematik, um sich in dieser Welt orientieren zu können.
Weiter östlich trat zur gleichen Zeit eine neue Gottheit in das Bewusstsein der Menschen. Ein allmächtiger Gott, der seinen Gläubigen Schutz anbot, sofern sie sich an seine Gebote hielten. Er sollte noch einige Jahrhunderte im Schatten der griechischen Götter stehen, um sie dann zu verdrängen. Die Logik konnte auch der neue Gott nicht beseitigen. Vielleicht will er es gar nicht.
Quellen:
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.