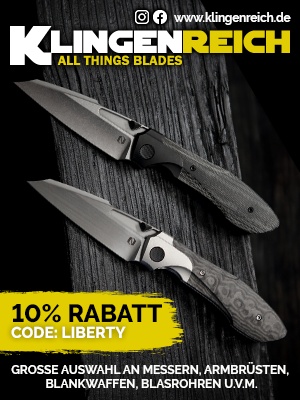Steuerparadies Italien: Mailand statt Berlin
Warum die Erfolgreichen über die Alpen ziehen
von Joana Cotar drucken

Manchmal sind es nicht die großen Revolutionen, die ein Land voranbringen, sondern die kleinen, beinahe unscheinbaren Änderungen. Italien, seit Jahren in den Schlagzeilen wegen Schuldenbergen und politischer Dauerkrisen, hat eine solche Änderung gewagt. Es hat still und leise eine Steueridee geboren, die heute ganze Vermögensströme umlenkt.
Stellen wir uns vor: Da sitzt ein Unternehmer in Paris, nennen wir ihn Jean-Luc. Sein Kalender ist prall gefüllt, die Firma läuft, die Gewinne sprudeln. Doch mit jedem Quartalsbericht stellt sich dasselbe Gefühl ein, von jedem Euro, der hereinkommt, bleibt nach den Steuern immer weniger übrig. Frankreich kennt keine Gnade, und die Reichen sind zunehmend im Fokus politischer Reden. „Solidarität“, heißt es. „Beitrag für die Gemeinschaft“, heißt es. Was in Sonntagsreden moralisch klingt, fühlt sich für Jean-Luc nach Montagskater an. Und plötzlich macht ihm ein Land ein Angebot, das er kaum ausschlagen kann.
Italien bietet eine sogenannte Flat Tax für Neuansiedler. Die Konstruktion ist simpel: Wer seinen steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegt, zahlt auf sämtliche Einkünfte aus dem Ausland nicht die üblichen progressiven Steuersätze, die in Italien genauso wie in Frankreich bis über 40 Prozent klettern können, sondern schlicht einen Pauschalbetrag von 200.000 Euro. Und das Beste daran: Diese Regel gilt bis zu 15 Jahre lang. Ob man zehn Millionen im Ausland verdient oder hundert Millionen – die Steuer auf dieses Einkommen in Italien bleibt fix.
Damit sich niemand mit halbgaren Tricks durchschummelt, gibt es Bedingungen. Der Antragsteller darf in den letzten neun Jahren kein italienischer Steuerresident gewesen sein. Wer also wirklich neu herzieht oder nach langer Auszeit zurückkehrt, qualifiziert sich und erhält eine Planungssicherheit, wie man sie in Europa selten findet.
Während in vielen europäischen Hauptstädten die Diskussion um höhere Abgaben für Reiche lauter wird, signalisiert Italien das Gegenteil: „Wir wollen euch. Wir geben euch Verlässlichkeit. Wir wissen, dass ihr mehr als nur Steuern mitbringt, nämlich Investitionen, Konsum, Netzwerke.“ In Rom hat man verstanden, dass Kapital wie Wasser ist. Wer will, dass es sich staut, muss Becken bauen.
Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Laut den Beratern von Henley & Partners wanderten allein im Jahr 2025 rund 3.600 Millionäre nach Italien ein. Damit landet das Land in der globalen Rangliste des Zuzugs von Vermögenden auf Platz drei, hinter den USA und den Emiraten, aber noch vor der Schweiz, die bislang als unangefochtenes Steuerparadies galt. Die italienischen Zeitungen schreiben längst vom „Ronaldo-Effekt“ – angeblich einer der ersten Prominenten, die von dem Modell profitierten, als er bei Juventus Turin spielte. Inzwischen sind es nicht mehr nur Fußballstars, sondern ganze Unternehmerfamilien, Fondsmanager, Tech-Investoren, die ihre Zelte in Mailand, Florenz oder Rom aufschlagen.
Und was machen diese Menschen dort? Sie zahlen nicht nur ihre Pauschale. Sie kaufen: Wohnungen mit Dachterrassen am Comer See, Villen in der Toskana, Apartments mit Blick auf das Forum Romanum. Einzelne Transaktionen liegen bei acht, zehn, fünfzehn Millionen Euro. Summen, die den lokalen Markt verändern und Handwerker, Architekten und Dienstleister mit Aufträgen versorgen. Kapital zieht Kapital an.
Doch nicht nur Immobilien boomen. Banken wie Julius Bär oder Ares Management eröffnen Büros in Mailand, Private-Banking-Vermögen strömt ins Land. Intesa Sanpaolo berichtet von Milliardenzuflüssen im Bereich Wealth Management. Es entsteht eine neue Dynamik, die Mailand plötzlich zum „neuen London“ machen könnte. Nicht nur, weil die britische Regierung ihre Non-Dom-Regel abgeschafft hat und damit reiche Ausländer verprellte. Sondern weil Italien eben nicht nur ein Steuerrefugium bietet, sondern zugleich Lebensqualität, Kultur und ein Klima, das man auch in Novembertagen erträgt.
Nun könnte man meinen, die Geschichte endet hier, Italien lockt Wohlhabende, kassiert seine Pauschale, und alle sind zufrieden. Doch Erfolge erzeugen Neider, vor allem sozialistische, und so tut sich ein Spalt in Europa auf – zwischen jenen, die Wettbewerb als Bedrohung sehen, und jenen, die ihn als Chance begreifen.
Frankreich gehört zu den Erstgenannten. François Bayrou, Premier in Paris, griff zu harschen Worten. Er sprach von „fiscal dumping“, einem unlauteren Unterbieten, das nicht nur Frankreich, sondern die europäische Solidarität gefährde. Er warnte vor einem Steuerwettbewerb nach unten, bei dem am Ende niemand gewinne, außer den Reichen. Bayrou hat da nicht ganz unrecht: Ja, Italien zieht Vermögende ab. Aber das sagt weniger über Italien aus, sondern viel mehr über Frankreich.
Rom konterte daher auch gelassen. Giorgia Meloni erklärte, Italien betreibe kein Dumping, sondern biete schlicht ein attraktives Modell für jene, die bereit seien, ins Land zu investieren und hier zu leben. Sie verwies auf die sinkende Defizitquote und steigende Investitionen; mit einem Unterton, der deutlich machte: „Wir machen hier nichts Illegales. Wir spielen das Spiel nur besser.“
Und tatsächlich, es ist kein Spiel mit gezinkten Karten, sondern eines mit offenen Regeln: Jeder weiß, was er zahlt. Jeder weiß, wie lange er zahlt. Keine Hintertür, keine versteckte Vermögensteuer, keine jährliche Zitterpartie vor dem Finanzminister. Für jemanden wie Jean-Luc aus Paris ist das mehr wert als das hübscheste Château an der Loire.
Die Folgen für den italienischen Alltag sind spürbar. Nicht nur Makler und Banker sind zufrieden, auch die Gastronomie erlebt ein Hoch, weil neue Vermögende nicht nur Wohnungen kaufen, sondern auch Lebensstil – und der beginnt beim Espresso in Brera und endet beim Dinner im Sterne-Restaurant an der Via Monte Napoleone.
Der für uns gebotene Vergleich mit Deutschland tut weh.
Denn während Italien Investoren anzieht, diskutiert Berlin über höhere Abgaben für Besserverdienende, über die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen und über Vermögensteuern. Statt Planbarkeit vermittelt man hier Unsicherheit. Statt Einladung ist alles Pflicht. Deutschland hat seine eigene linke Logik, den Drang nach Umverteilung, Enteignungsphantasien. Als Ergebnis fragt sich das Kapital: „Warum hierbleiben?“
Während Rom den roten Teppich ausrollt, verlegt Berlin Stolpersteine. Man vergisst, dass erfolgreiche Menschen nicht nur Steuerzahler sind, sondern Arbeitgeber, Investoren, Konsumenten. Wer sie als Problem behandelt, verliert sie. Wer sie als Ressource begreift, gewinnt. So einfach ist das.
Wettbewerb ist nicht unfair, er ist die Essenz von Fortschritt. Wer klug ist, passt sich an, wer starr bleibt, verliert. Italien hat hier einfach schneller begriffen, dass Kapital nicht moralisch denkt, sondern rational.
Während Berlin über Sozialabgaben philosophiert, sprudelt in Mailand der Champagner. Während Paris von Solidarität predigt, eröffnen in Rom neue Private-Banking-Büros.
Es ist wie bei einem Garten, man kann das Wasser versickern lassen oder man baut Kanäle, die es auf die richtigen Felder lenken. Italien baut diese Kanäle. Frankreich gräbt Gräben und Deutschland diskutiert über die Farbe der Gießkanne.
Steuerpolitik sollte nicht bestrafen, sondern ermöglichen. Sie sollte nicht bremsen, sondern bewegen. Wer glaubt, dass hohe Steuern für Reiche alle Probleme lösen, vergisst, dass Kapital längst global geworden ist; nur wer attraktive Bedingungen schafft, hält es fest und gewinnt schließlich mehr als nur Steuern – nämlich Zukunft.
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.