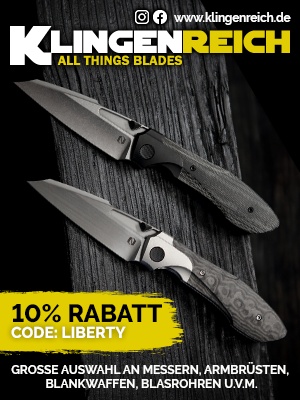Eurosklerose: Lehren aus der „Quartz“-Krise
Europas Weg aus der Stagnation

Die Schweizer Uhrenindustrie brach fast über Nacht zusammen. Die Japaner drangen Anfang der achtziger Jahre mit ihren Quarzuhren auf den Markt, die genauer und billiger waren als mechanische Uhren. Es muss sich angefühlt haben wie der Mongolensturm in Ungarn im Jahr 1241: Die Lage war hoffnungslos.
Die Banken beauftragten ein kleines Consulting-Büro mit der Liquidation der Société de Microélectronique et d’Horlogerie (SMH). Die Schweizer Uhrenindustrie – oder das, was davon übrig war – sollte „abgewickelt“ werden.
Der Turnaround
Der Consultant, Nicolas Hayek, analysierte die Marken und die Herstellungsprozesse und schlug statt der Liquidation eine neue Strategie vor. Ein Jahrzehnt später mutierte die Liquidationsmasse zum größten Uhrenkonzern der Welt.
Der Schlüssel zum Erfolg war die Swatch (Second-Watch): eine trendige Quarzuhr und ein Modeaccessoire, das auch die Zeit anzeigte. Der Erfolg war durchschlagend: Japanische Uhren gab es bald nur noch auf dem türkischen Basar – mit Ausnahme von Citizen, Seiko und Casio. Die Swatch Group – der neue Name der SMH – war so erfolgreich, dass sie ihre klassischen Marken (Longines, Mido, Rado, Hamilton, Tissot, Certina und Balmain) und ihre Luxusbrands (Omega, Glashütte, Breguet, Blancpain, Jaquet Droz und Harry Winston) vor dem Untergang bewahrte. Mehr noch: Sie wurden ebenfalls zu Cashcows. Die Umsatzrendite erreichte 15 Prozent, die Aktie wurde zum Liebling der Investoren.
Was der Schweizer Uhrenindustrie widerfuhr, ist heute ein Lehrstück für die gesamte europäische Industrie. Der Kontinent ist die Heimat fast aller Marken, die von den fähigsten Ingenieuren entwickelt und von den gewissenhaftesten Arbeitern gebaut werden – aber sie sind hoffnungslos überteuert. Dies scheint den Chinesen bewusst zu sein. Ab und an kaufen sie eine europäische Marke und fahren sie dann an die Wand (SAAB). Markenmanagement ist den Chinesen fremd, bei ihnen zählt „billig“. Das erreicht man jedoch nur mit großen Serien und hoher Standardisierung. Im besten Fall sieht das dann so aus wie ein amerikanischer Chevrolet, im schlechtesten Fall wie ein Lada.
Zurück zur Qualität
Die erste Lektion aus der Quarzkrise: Zurück zur Qualität!
Die Qualität lässt sich nur erreichen, wenn die Produktion in Europa stattfindet. Europa hat weder die Kaufkraft des amerikanischen Marktes noch die niedrigen chinesischen Lohnkosten. Gleichzeitig vergessen die Europäer, dass auch die Konkurrenten massive Schwächen haben. Die große Masse der amerikanischen Arbeiterschaft ist unqualifiziert. Amerikanische Produkte werden nie die europäischen Qualitätsstandards erreichen. Die Chinesen sind Meister der Massenproduktion: geschickt, fleißig, aber nicht an Qualität orientiert.
Swatch Story – Teil 2
Mit einem Paradigmawechsel in Richtung Qualität ist Europa nicht gerettet. Hier kommt die zweite Lektion:
Das Billigsegment (Swatch) verlor zunehmend an Umsatz. Die Ursache waren weder mangelnde Innovation noch hohe Preise. Die Menschen fanden es schlichtweg nicht mehr cool, Uhren zu tragen. Das Smartphone erfüllt die gleiche Funktion. Die Swatch Group fand sich mit dieser Entwicklung ab. Den Absatzrückgang kompensierte sie mit höheren Preisen. Kostete eine Swatch bei der Lancierung 39,90 Schweizer Franken, ist der Durchschnittspreis heute für das trendige Gadget über 100 Franken. Die Swatch hat sich selbst aus dem Billigsegment „herausgepreist“.
Börsenkurs als Referenz
Das kümmerte die Swatch Group wenig. Der Sohn des Gründers, Nick Hayek, richtet seinen Kompass nach dem Börsenkurs. Die Marktführerschaft in den einzelnen Preissegmenten ist ihm sekundär. Es funktionierte: Zwar verdiente man im untersten Preissegment nicht mehr gut, doch die Marken- und Luxusuhren spülten so viel Geld in die Kasse, dass die Aktie sich in sagenhafte Höhen aufschwang – und nur das schien zu zählen.
Luxusprodukte haben jedoch eine gefährliche Eigenschaft: Geht es wirtschaftlich bergab, sind sie die ersten, die von der Einkaufsliste gestrichen werden. Corona und die Wirtschaftspolitik Trumps belasten den größten Absatzmarkt der Swatch Group – Asien – schwer.
Es kam, wie es kommen musste: Beim Anblick des Börsenkurses muss es Nick Hayek jeden Tag kalt den Rücken herunterlaufen. Der Aktienwert ist in den letzten zehn Jahren von 600 Schweizer Franken auf 150 Schweizer Franken gefallen. Die Umsatzrendite der Swatch Group ist auf drei Prozent gesunken, was sie irgendwo in der Kategorie zwischen Aldi und Bahnhofskiosk einordnet. Zum Vergleich: Die Rendite von Apple beträgt 31 Prozent.
Der Tier-Lock
Innerhalb der Swatch Group können sich die Marken kaum bewegen. Tissot kann keine teureren Uhren herstellen, weil es Omega die Kunden abgraben würde. Billiger geht auch nicht, die Swatch oder eine andere Marke des Konzerns würde darunter leiden. Ist eine Marke einmal in einem (Image-)Segment innerhalb des Konzerns positioniert, endet die Innovation – es sei denn, sie senkt die Kosten. Ökonomen nennen dieses Phänomen den „Tier-Lock“.
Lektion 2: Zerschlagt die Konzernstrukturen!
Die zweite Lektion aus der Geschichte der Swatch ist folgende: Das billige Geld der Zentralbanken hat die Konzernbildung begünstigt. Konzerne kaufen Marken auf und integrieren sie in ihre bestehende Struktur. Das ergibt Synergieeffekte, die die Umsatzrendite und letztlich den Aktienkurs erhöhen. Die Kehrseite ist das Ende der Innovation: Der Kunde erhält lediglich jedes Jahr alten Wein in neuen Schläuchen. Konzerne verfügen zudem über erhebliche politische Hebel, die die Gesetzgebung zu ihren Gunsten beeinflussen können. Damit killen sie nicht nur die Konkurrenz, sondern vor allem die Mittelständler, ohne dass die Bevölkerung viel davon merkt.
Die Markenführerschaft im untersten Segment
Die Swatch Group hat noch eine dritte Lektion zu bieten, die den meisten Analysten entgeht. Entscheidend für die Etablierung einer Marke ist die Marktführerschaft im untersten Preissegment. Vater Hayek gelang genau das. Das Produkt muss nicht das billigste sein, aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten (Value-for-Money-Strategy).
Dritte Lektion: Marktführerschaft im untersten Preissegment!
Nicht nur die Swatch ist ein solches Beispiel. Wir begegnen dieser Strategie immer wieder. Die 3D-Drucker von Prusa waren beispielsweise genau das: Sie waren zuverlässig und langlebig, aber doppelt so teuer wie die chinesische Konkurrenz. Doch die Chinesen schliefen nicht und griffen diese Marktführer gezielt an – meistens mit großzügigen, verdeckten Subventionen durch den Staat. Beispiele hierfür sind BYD, BambuLab, DJI usw. Die Amerikaner lassen sich dieses Spiel nicht mehr bieten und reagieren mit Strafzöllen.
Die EU ist zu schwach und bereits zu abhängig von China, um sich dieser Praxis entgegenzustellen. Auch den amerikanischen Zöllen hat die EU nichts entgegenzusetzen. Die Rettung kann nur aus dem Mittelstand kommen, doch genau dem macht man mit Abgaben und Auflagen das Leben zur Hölle.
Eurosklerose
Den Konzernen ist bewusst, dass sie diese Misere kaum beeinflussen können. Um ihre Umsatzrendite nicht noch weiter zu gefährden, dürfen sie die Chinesen nicht verärgern. Sie sind zu stark auf deren Markt und die Lieferanten angewiesen. Stattdessen lobbyieren sie für Zölle auf Temu & Co., was die Lebenshaltungskosten der unteren sozialen Schichten noch weiter in die Höhe treiben würde.
Die Eurosklerose ist hausgemacht.
Quellen:
Société de Microélectronique et d'Horlogerie - Wikipedia
https://www.swatchgroup.com/en
Kommentare
Die Kommentarfunktion (lesen und schreiben) steht exklusiv nur registrierten Benutzern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie sich mit dem Registrierungsformular ein kostenloses Konto erstellen.